
SocialMedia-Kampagne Klartext gegen Faschismus
Auf dieser Seite findet ihr die gesammelten Bilder und Texte unserer SocialMedia-Kampagne “Klartext gegen Faschismus”. Ladet die Materialien gerne herunter und nutzt sie für eure Arbeit vor Ort.
Inhalt
- Internationaler Tag der Migrant*innen
- Ableismus
- Internationaler Gedenktag für die Opfer von Völkermorden
- Pressefreiheit
- Mölln, 23.11.92
- Internationaler Tag für Toleranz
- Novemberpogrome
- rechte Stiftungen
- Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche & Rechtsextremismus (BAG K+R)
- QAnon
- Halle, 9.10.19
- Tag der Deutschen Einheit
- Oktoberfest-Attentat
- “Ische”
- Marsch für das Leben
- Verschwörungsideologie
- Antikriegstag
- Rostock-Lichtenhagen
- Bau der Berliner Mauer
- Weltjugendtag
- zivile Seenotrettung
- München, 22.7.16
- “Weimarer Verhältnisse”
- Autokratie
- “Eskimo” vs. “Inuit”
- “#Stolzmonat”
- Amadeu Antonio Stiftung
- “christliche Werte”
- Walter Lübcke
- “Schachern”
- Hufeisentheorie
- Bücherverbrennung
- 10 Jahre NSU-Prozess
- Vielfalt-Mediathek
- Rechtsextremismus
- Gender-Ideologie
- Autoritarismus-Studie
- Mobile Beratung
- Ermächtigungsgesetz
- Reichsbürger*innen
- Antifeminismus
- Rechtspopulismus
- Die Weiße Rose
- Hanau, 19.2.20
- Antifaschismus
- “Reibach”
- Netzwerk Demokratie und Courage
- “Mauscheln”
- Faschismus
- Blackfacing
Internationaler Tag der Migrant*innen

Heute (18.12.23) ist der Internationale Tag der Migrant*innen. Das ist ein Gedenktag der Vereinten Nationen (UNO), der auf die Situation der Menschen mit internationaler Familiengeschichte aufmerksam machen soll.
In Deutschland hatten im Jahr offiziellen Zahlen zufolge 22,3 Millionen Menschen einen sogenannten “Migrationshintergrund”. Das ist mehr als jeder vierte Mensch. Viele dieser Menschen erleben trotzdem regelmäßig Rassismus, einige sogar täglich. Das darf nicht länger so bleiben! Wir müssen uns endlich auf den Weg machen, zu einer Gesellschaft zu werden, in der jede*r einen Platz hat.
Ableismus

Hast du schonmal von dem Wort „Ableismus“ gehört? Es ist das Fachwort dafür, wenn Menschen aufgrund einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung oder aufgrund von Lernschwierigkeiten benachteiligt werden oder Vorurteilen ausgesetzt sind. Es handelt sich also um eine Form von Diskriminierung.
Dabei gibt es abwertenden und aufwertenden Ableismus. Dazu das Beispiel eines Menschen im Rollstuhl: Wenn der*die Busfahrer*in diesen Menschen beim Einsteigen genervt dazu auffordert, beim nächsten Mal nicht den Bus zu nehmen, da die Einstiegshilfe die Abfahrt verzögere, handelt es sich um abwertenden Ableismus. Wenn ein anderer Fahrgast hingegen sagt: „Ich finde es toll, dass Sie es auch im Rollstuhl schaffen, den Bus zu nehmen“, dann handelt es sich um aufwertenden Ableismus. Auch dieser ist für die betroffene Person verletzend, da sie so auf ein bestimmtes Merkmal (hier auf den Rollstuhl) reduziert wird.
Ableismus ist in extrem rechten Gruppen weit verbreitet, da ihre Mitglieder Menschen mit Beeinträchtigungen als „weniger wert“ betrachten. Auch unsere Sprache ist an vielen Stellen oft unbewusst ableistisch. In der KjG versuchen wir dagegen, alle Formen des Ableismus zu vermeiden. Daher haben wir das Thema Inklusion zu einem unserer Schwerpunktthemen bestimmt.
Internationaler Gedenktag für die Opfer von Völkermorden

Heute (9.12.23) ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Verbrechens des Völkermordes und ihrer Würde und der Verhütung dieses Verbrechens. Er findet jährlich am 9. Dezember statt, dem Jahrestag der UN-Völkermordkonvention von 1948.
Als Völkermord werden Handlungen bezeichnet, die das Ziel haben, eine „nationale, ethnische, rassische oder religiöse“ Gruppe von Menschen ganz oder teilweise zu zerstören. Mit der Völkermordkonvention verpflichten sich alle unterzeichnenden Staaten, dieses Verbrechen zu verhindern und zu bestrafen.
Am heutigen Tag gedenken wir der Menschen, die weltweit Völkermorden zum Opfer gefallen sind, insbesondere aber auch den Opfern deutscher Täter*innen: Den Angehörigen der Volksgruppen der Herero und Nama im heutigen Namibia, die Anfang des 20. Jahrhunderts den deutschen Kolonialtruppen zum Opfer fielen. Und den Jüdinnen*Juden sowie den Sinti*zze und Rom*nja, die von den Nationalsozialist*innen verfolgt und ermordet wurden. Es ist wichtig, die Erinnerung an die Taten wach zu halten, um sie in der Zukunft zu verhindern.
Pressefreiheit
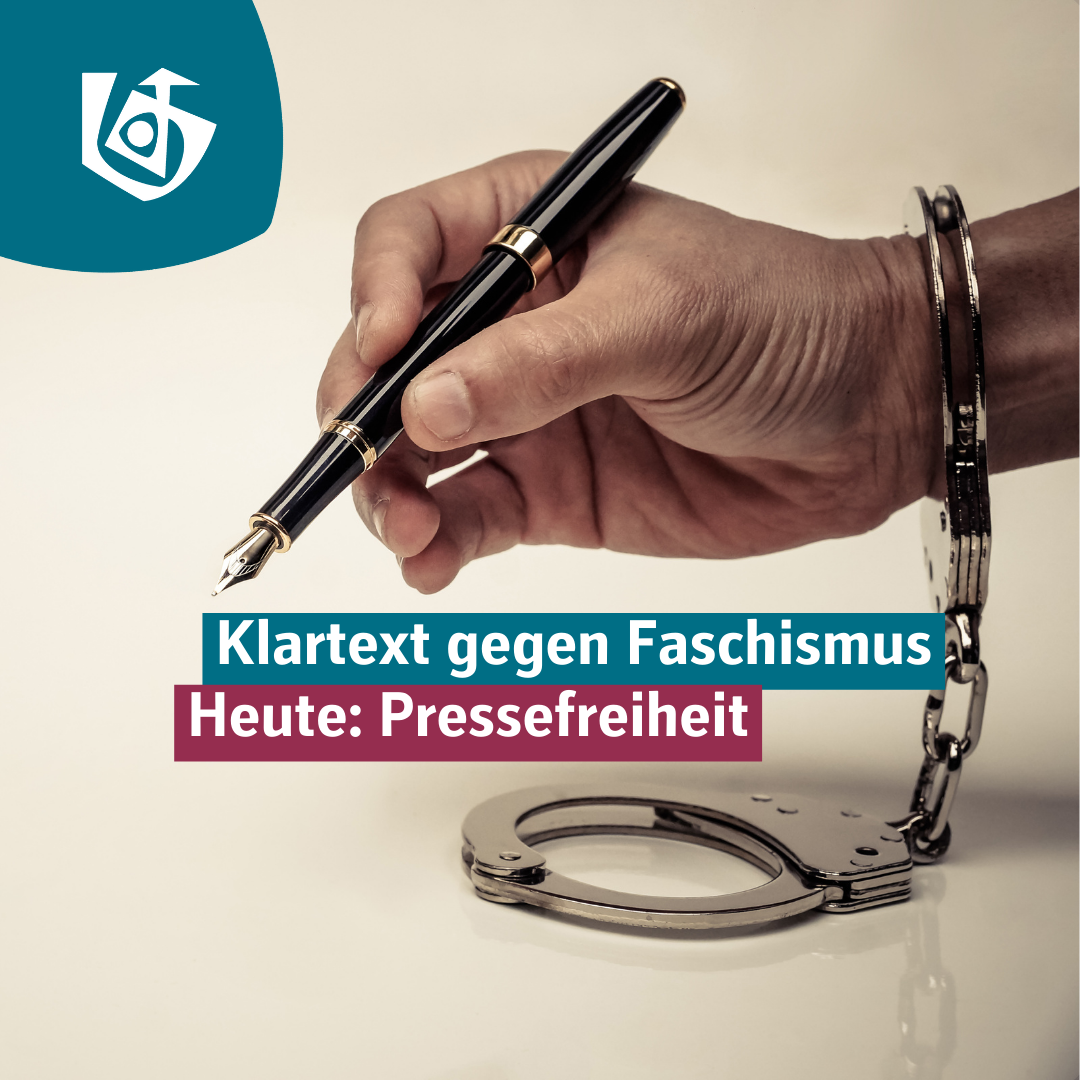
Pressefreiheit ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. Mit dem Begriff Pressefreiheit ist gemeint, dass Medien wie Zeitungen, Radio oder Fernsehen unabhängig von äußeren Einflüssen oder Anweisungen ihrer journalistischen Arbeit nachgehen können. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Staat den Medien weder vorschreiben noch verbieten darf, über etwas bestimmtes zu berichten. Außerdem müssen Journalist*innen ohne Angst vor Angriffen, Beleidigungen und ähnlichem ihrer Arbeit nachgehen können. Die Pressefreiheit ist ein zentraler Bestandteil der demokratischen Willensbildung, der Meinungsvielfalt und der Kontrolle der Politik durch die Öffentlichkeit.
In Deutschland ist die Pressefreiheit in Artikel 5 des Grundgesetzes festgeschrieben. Trotzdem ist Deutschland in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit in den letzten Jahren drei Mal hintereinander abgestiegen. Aktuell steht es nur noch auf Platz 21. Das liegt vor allem daran, dass es viele Angriffe auf Journalist*innen, Fotograf*innen etc. gab. Allein im Jahr 2022 waren es 103 Angriffe. Viele dieser Angriffe wurden von extrem rechten Akteur*innen durchgeführt, um Menschen einzuschüchtern, die sich gegen Rechts engagieren.
Wir fordern, die Pressefreiheit in Deutschland und weltweit effektiv zu schützen und weiter auszubauen, denn ohne funktionierende Pressefreiheit gibt es keine Demokratie.
Mölln, 23.11.92

Heute vor 31 Jahren verübten zwei Neonazis in der Kleinstadt Mölln in Schleswig-Hollstein einen Brandanschlag auf zwei Häuser, in denen Familien mit türkischen Wurzeln lebten. Drei Menschen kamen durch den Brand ums Leben: Bahide Arslan im Alter von 51 Jahren, Ayşe Yılmaz im Alter von 14 Jahren und Yeliz Arslan im Alter von 10 Jahren. Neun weitere Menschen wurden schwer verletzt. Heute gedenken wir der Opfer dieses grausamen Anschlags.
Die beiden Täter, 19 und 25 Jahre alt, konnten einige Tage nach der Tat ermittelt und verhaftet werden. Im Verhör gestanden sie zunächst, widerriefen das Geständnis jedoch vor Gericht. Sie wurden zu zehn Jahren Jugendstrafe bzw. zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Das Leid, das sie angerichtet haben, kann dadurch aber nicht wieder gut gemacht werden.
Ein entschlossenes Eintreten gegen extrem rechte Gedanken und Taten ist schon in den Anfängen wichtig, damit sich Anschläge wie in Mölln nicht wiederholen.
Internationaler Tag für Toleranz

Heute (16.11.2023) ist der Internationale Tag für Toleranz. Dieser Tag findet jedes Jahr am 16. November statt und geht auf eine Initiative der Vereinten Nationen (UN) aus dem Jahr 1995 zurück. Ziel des Tages ist es, die Öffentlichkeit für die Gefahren von Intoleranz zu sensibilisieren und zum Einsatz für mehr Toleranz aufzurufen.
Dieser Aufruf richtet sich an jede*n Einzelne*n, aber auch an Gruppen und Staaten. Gemeint ist damit nicht Nachsicht, sondern ein aktives Eintreten für Menschenrechte, Pluralismus, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das bedeutet, dass wir als tolerante Menschen Intoleranzen wie Rassismus, Antifeminismus oder Antisemitismus nicht hinnehmen müssen, sondern klar zurückweisen können.
Als KjG setzen wir uns seit unserer Gründung für Frieden und Verständigung ein. Daher möchten wir heute den Wert einer toleranten Gesellschaft noch einmal unterstreichen.
Novemberpogrome

Heute (9.11.2023) jähren sich zum 85. Mal die Novemberpogrome der Nationalsozialist*innen an der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden zahllose jüdische Synagogen und Friedhöfe sowie Geschäfte und Wohnungen jüdischer Menschen zerstört. Mehrere hundert Jüdinnen*Juden wurden ermordet oder begingen Suizid, mindestens 30.000 wurden inhaftiert. Viele starben später an den Folgen. Heute gedenken wir der zahlreichen Opfer der Pogrome.
Diese Nacht war zugleich der Übergang von der Diskriminierung hin zur organisierten Vertreibung und Unterdrückung jüdischer Menschen. Anders als von den Nazis behauptet, war sie keine spontane Aktion der Bevölkerung, sonder von langer Hand durch das Regime geplant.
Es ist wichtig, das Gedenken an die Opfer und die Geschehnisse auch in der Gegenwart lebendig zu halten, um gemeinsam an einer besseren Gegenwart und Zukunft zu arbeiten.
rechte Stiftungen

In Artikel 23 des Grundgesetzes ist festgeschrieben, dass die Parteien “bei der politischen Willensbildung des Volkes” mitwirken. Um diese Aufgabe zu erfüllen, gibt es Stiftungen, die den Parteien nahe stehen. Sie bieten beispielsweise Seminare zur politischen Bildung an oder vergeben Stipendien an Studierende. Dafür erhalten sie jedes Jahr hohe staatliche Förderungen.
Doch was, wenn diese Stiftungen demokratie- und grundgesetzfeindliche Werte vertreten, wie zum Beispiel die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung? Soll auch diese mit staatlichen Geldern gefördert werden? Wir finden: ganz klar nein! Staatliche Mittel dürfen nur an demokratische Akteur*innen vergeben werden. Wir begrüßen daher, dass die Ampel-Parteien und die Union ein Gesetz planen, nach dem diese Stiftungen nur dann Geld erhalten, wenn sie sich aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Völkerverständigung einsetzen.
Die Demokratie muss sich gegen ihre Feind*innen wehren.
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche & Rechtsextremismus (BAG K+R)
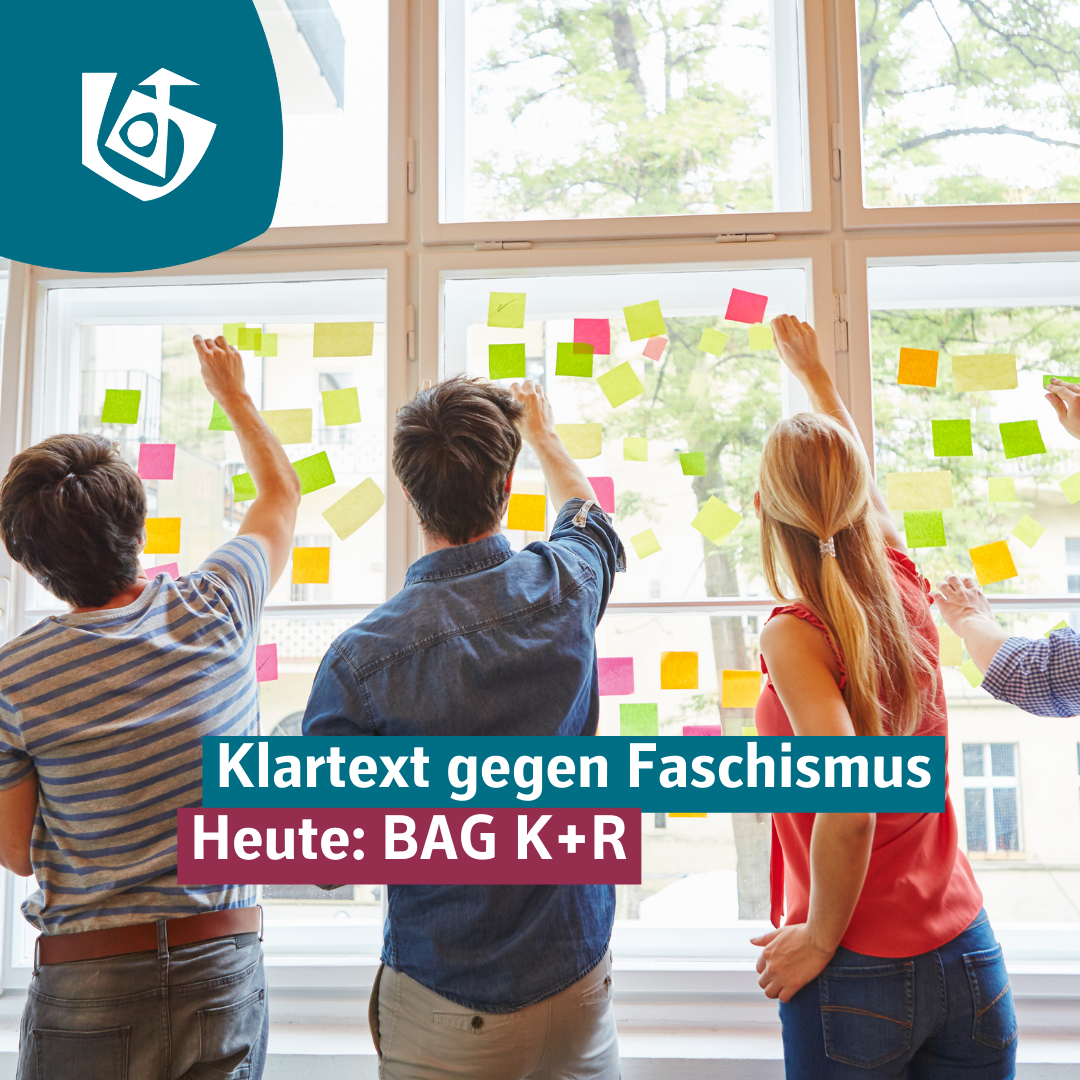
Kennst du schon die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAG K+R)? Darin haben sich verschiedene Akteur*innen aus der katholischen und der evangelischen Kirche zusammengeschlossen, um Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aktiv und aus einer christlichen Grundhaltung heraus entgegenzutreten.
Die BAG K+R organisiert Fachtagungen und Fortbildungen, veröffentlicht Flyer und Broschüren und berät Multiplikator*innen und Leitungskräfte im kirchlichen Raum. Schau doch mal auf der Website der BAG vorbei, dort gibt es Einiges zu entdecken: https://bagkr.de/
QAnon
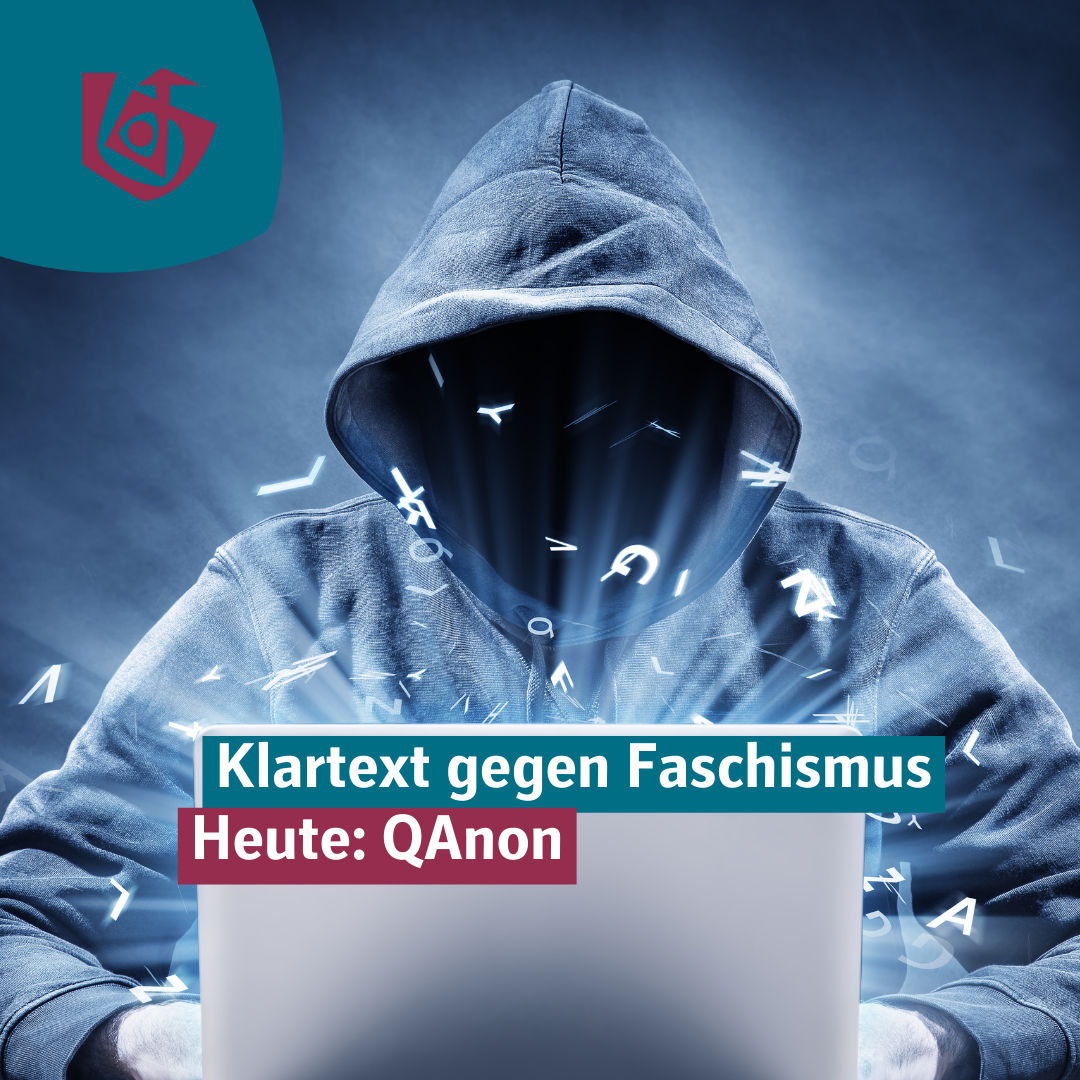
Hast du schonmal von QAnon gehört? Dabei handelt es sich um eine gefährliche Verschwörungsideologie. Sie entstand in den USA, fasst inzwischen aber auch in Deutschland Fuß. Heute schauen wir uns diese Verschwörungsideologie einmal näher an.
Der*die anonyme Urheber*in von QAnon veröffentlichte erstmals 2017 Behauptungen im Internet, in denen er*sie sich mit einem Kampf gegen einen angeblichen „Deep State“ auseinandersetzte. Dieser „Deep State“ soll ein Geheimbund von Menschen in hohen und höchsten Regierungsämtern und öffentlichen Positionen sein, der Kinder entführe, um ein Verjüngungsserum herzustellen. Belege für diese Behauptungen gibt es keine. Vielmehr gibt es enge Verknüpfungen zum Antisemitismus. Dazu kommen noch weitere unbelegte Theorien. Unter anderem, dass der angebliche Geheimbund einen Putsch plane, um in den USA eine Diktatur zu errichten.
Da es bereits Gewalttaten durch QAnon-Anhänger*innen gab und ihre Ideologie auf die Delegitimierung von Staat und Demokratie abzielt, handelt es sich um ein gefährliches Phänomen, das beobachtet und bekämpft werden muss.
Halle, 9.10.19

Heute jährt sich der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle zum vierten Mal. Am 9. Oktober 2019 versuchte ein rechtsextremer Täter in die Synagoge einzudringen. Dort wurde Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, gefeiert. Glücklicherweise gelang es dem Täter nicht, die Eingangstür zu öffnen. Er ergriff daraufhin die Flucht. Dabei erschoss er zwei Passant*innen und verletzte zwei weitere, bevor er verhaftet wurde. Der Täter wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Er wird also nie wieder aus dem Gefängnis freikommen.
Heute denken wir an die Opfer, Jana Lange und Kevin Schwarze, und an die Überlebenden des Anschlags. Und wir fordern, dass aus dem Geschehenen Konsequenzen gezogen werden. Dass die Polizei die Synagoge trotz des dort stattfindenden Gottes+dienstes nicht gesondert geschützt hat, war ein schwerer Fehler. Die antisemitische Bedrohung jüdischer Menschen in Deutschland ist real und muss von den Behörden ernst genommen und bekämpft werden.
Tag der Deutschen Einheit

Heute (3.10.) ist der Tag der Deutschen Einheit. Ein solcher Nationalfeiertag ist ein guter Anlass, auf den aktuellen Zustand des Landes zu schauen, in dem er begangen wird. Das möchten wir in diesem Jahr mit einem Fokus auf das Thema Migration tun:
Menschen, die nach Deutschland kommen wollen oder die bereits hier sind, wird es an vielen Stellen sehr schwer gemacht. Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis sind kaum zu bekommen. Einbürgerungsverfahren sind kompliziert und langwierig. Und (struktureller) Rassismus ist noch immer ein Problem. Dies wird auch dadurch verstärkt, dass in Politik und Medien oft nur in negativen Zusammenhängen über Migration gesprochen wird. Die Chancen, die sie mit sich bringt, und die individuellen Beweggründe der Menschen werden ausgeblendet oder abgewertet. Zwar benennen Politiker*innen im Zusammenhang mit dem massiven Arbeitskräftemangel immer wieder die Notwendigkeit von Zuwanderung. Dennoch verlassen viele Menschen Deutschland wieder, weil sie sich hier nicht willkommen fühlen.
Wir sollten den Tag der Deutschen Einheit zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, wie wir Deutschland immer weiter zu einem weltoffenen Land entwickeln können, in dessen bunter Gesellschaft für alle Platz ist.
Oktoberfest-Attentat

Heute vor 43 Jahren (26.09.1980) wurde das Münchener Oktoberfest von einem rechtsextremen Terroranschlag getroffen. 13 Menschen starben, 221 weitere wurden verletzt. Es war der schwerste Terrorakt in der Geschichte der Bundesrepublik.
Unter den Toten war auch der Täter. Er war Mitglied mehrerer rechtsextremer Gruppen. Die Ermittler*innen gingen allerdings davon aus, dass er allein und aus persönlichen Motiven gehandelt habe. Jedoch verwiesen Zeug*innen-Aussagen und andere Spuren auf mögliche rechtsextreme Mittäter*innen.
Die Bundesanwaltschaft nahm daher von 2014 bis 2020 die Ermittlungen wieder auf. Sie stellte fest, dass die Tat ein rechtsextremer Terrorakt war, der die Bundestagswahl 1980 beeinflussen sollte. Anstifter*innen, Mittäter*innen oder Mitwisser*innen ließen sich weder beweisen noch ausschließen. Die Fehler der ursprünglichen Ermittler*innen wurden nicht aufgeklärt.
Wir fordern auch heute konsequente Verfolgung rechter Übergriffe und Gewalttaten. Dazu gehört auch, diese nicht als Einzelfälle abzutun.
“Ische”
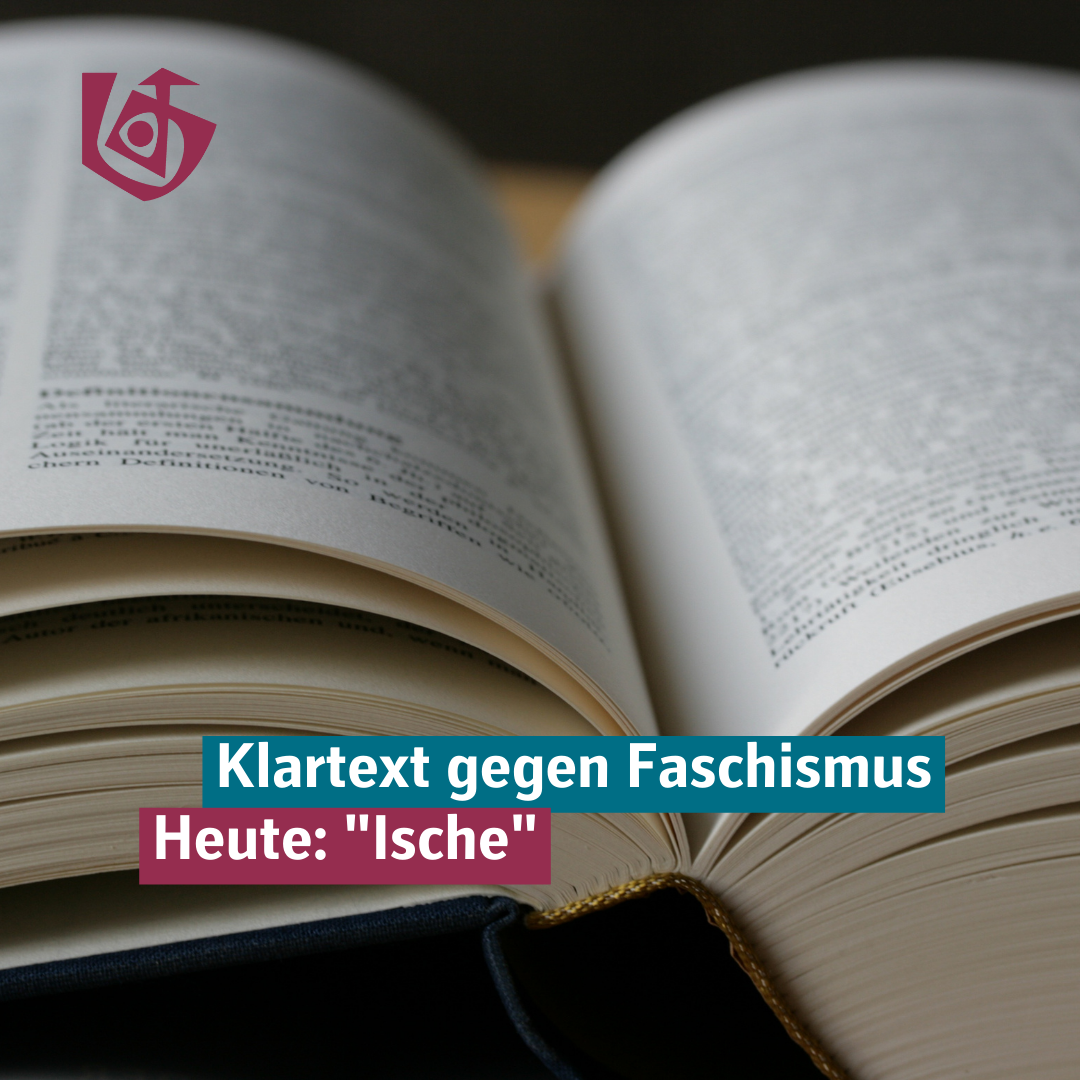
Hast du schonmal mitbekommen, dass eine junge Frau als „Ische“ bezeichnet wurde? Wo diese Bezeichnung herkommt, schauen wir uns heute an.
Der Begriff stammt aus dem Jiddischen. Diese Sprache wurde bis ins letzte Jahrhundert von vielen Jüd*innen in Deutschland gesprochen. Dort bedeutet er „Frau“. In seiner heutigen Verwendung ist der Begriff allerdings eher negativ besetzt.
Meist schwingt in ihm eine sexualisierende Sichtweise mit oder die so bezeichnete Frau soll als sonderbar dargestellt werden. Dass der Begriff, anders als in seiner ursprünglichen jiddischen Bedeutung, in der deutschen Sprache eher negativ verwendet wird, bringt ihn außerdem mit antisemitischen Vorstellungen in Verbindung. Daher finden wir es besser, auf seine Verwendung zu verzichten.
Marsch für das Leben

Heute (16. September 2023) findet in Berlin und in Köln der sogenannte “Marsch für das Leben” statt. Die Teilnehmer*innen tragen schweigend weiße Kreuze durch die Stadt und demonstrieren damit vor allem gegen Schwangerschaftsabbrüche, aber auch gegen Sterbehilfe oder Stammzellenforschung. Sie berufen sich dabei auf ihre christliche Überzeugung und beenden die Kundgebung mit einem Gottes+dienst. Regelmäßig laufen in der ersten Reihe extrem rechte Akteur*innen mit, zum Beispiel AfD-Politiker*innen.
Trotzdem nehmen immer wieder auch katholische Bischöfe an der Veranstaltung teil oder senden Grußworte. Den extrem rechten Akteur*innen wird somit eine prominente Bühne geboten, die sie gerne nutzen. In diesem Jahr hat Georg Bätzing als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ein Grußwort geschickt. Das finden wir erschreckend und fordern den Bischof auf, Grußworte wie dieses zu überdenken.
Außerdem problematisch ist, dass die Aktivist*innen vom Marsch für das Leben ihren Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche auf dem Rücken ungewollt schwangerer Frauen austragen, wenn sie Abtreibungen mit Morden gleichsetzen. Es muss die Aufgabe der Kirche sein, Menschen in persönlich herausfordernden Lebensphasen zur Seite zu stehen, statt über sie zu urteilen.
Wir fordern daher die katholischen Amtsträger auf, den Marsch für das Leben nicht weiter zu unterstützen und sich stattdessen einer zeitgemäßen Debatte zum Thema Lebensrecht zu stellen.
Verschwörungsideologie

Schon öfter gehört, aber: Was genau ist eigentlich eine Verschwörungsideologie?
Eine Verschwörungsideologie ist der Versuch, ein Ereignis oder auch einen Zustand durch eine Verschwörung zu erklären. Also durch das meist geheime und illegale Agieren einer kleinen Gruppe von Akteur*innen.
Das Spezielle an einer Verschwörungsideologie ist, dass sie eine Überprüfung ihrer Erklärung nicht zulässt. Ihre Anhänger*innen halten trotz gegenteiliger Beweise an ihr fest. Dadurch wird die Erklärung zu einer unhinterfragbaren „Ideologie“ mit der ein ganzes Weltbild einhergeht. Dieses ist in der Regel stereotyp und eindimensional. In den meisten Fällen sind die Stereotype dabei auch antisemitisch, da sie auf eine vermeintliche „Weltverschwörung“ abzielen.
Antikriegstag
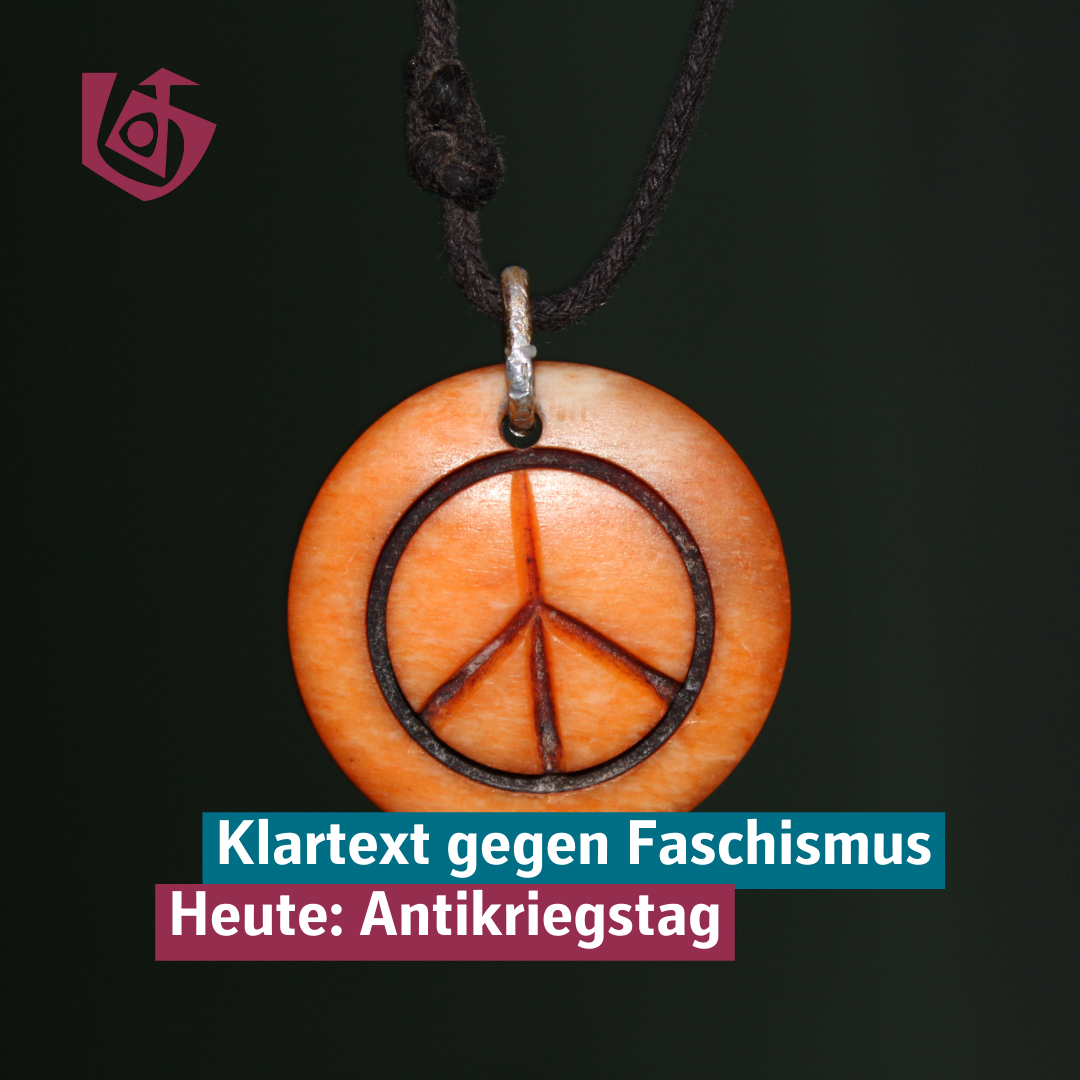
Heute ist Antikriegstag. Das geht zurück auf eine Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in den 50er-Jahren. Der Antikriegstag findet damit am Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen statt, mit dem 1939 der Zweite Weltkrieg begann. Er soll an den Beginn des Kriegs erinnern und gleichzeitig dafür stehen, dass es nie wieder zu einem solchen Krieg kommen darf.
Der Antikriegstag wird zugleich auch von Neonazis für die eigenen Zwecke instrumentalisiert. Vordergründig demonstrieren sie für den Frieden. Tatsächlich versuchen sie dabei, die Ursachen des Zweiten Weltkriegs umzudeuten und die deutsche NS-Vergangenheit aufzuwerten. Sie behaupten, das nationalsozialistische Deutschland sei von anderen Staaten „eingekreist“ worden und habe keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem Krieg dagegen zu verteidigen. So stellen sie Deutschland als Opfer des Zweiten Weltkriegs dar und verschweigen dabei bewusst zum Beispiel die Aufrüstungspolitik des Nationalsozialismus oder die Millionen Opfer des Regimes. Die Demokratisierung nach dem Zweiten Weltkrieg und die Hinwendung zur westlich-amerikanischen Kultur betrachten die Neonazis als „Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln“, da dadurch die „deutsche Volksgemeinschaft“ zerstört worden sei.
Dieser Verdrehung der Geschichte durch Neonazis treten wir klar entgegen.
Rostock-Lichtenhagen

Zwischen dem 22. und 26. August 1992 kam es im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu mehreren schweren Angriffen auf die “Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber*innen” sowie auf das danebengelegene Sonnenblumenhaus, einem Wohnheim für vietnamesische “Vertragsarbeiter*innen”. An den Angriffen beteiligten sich mehrere hundert Täter*innen, darunter zahlreiche Neonazis aus ganz Deutschland. Unterstützt wurden sie von weit über 1.000 Schaulustigen. Die Polizei war schlecht ausgerüstet und mit der Situation überfordert. Bis heute ist strittig, ob die politisch Verantwortlichen die Übergriffe sogar billigend in Kauf nahmen.
Vielen Bewohner*innen des Sonnenblumenhauses gelang nur knapp die Flucht aus dem in Brand gesteckten Gebäude. Eine Entschädigung erhielten die Betroffenen nicht. Viele wurden stattdessen abgeschoben. Die juristische Aufarbeitung der Taten verlief langsam und die gesprochenen Urteile waren auffallend mild.
Auch heute kommt es wieder vermehrt zu Übergriffen auf Unterkünfte für geflüchtete Menschen. Es ist wichtig, dass Politik, Behörden und Gesellschaft sich dem klar entgegenstellen. Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, müssen hier in Sicherheit leben können. Gleichzeitig müssen gewaltsame Übergriffe wie die in Rostock-Lichtenhagen zügig aufgeklärt werden.
Bau der Berliner Mauer
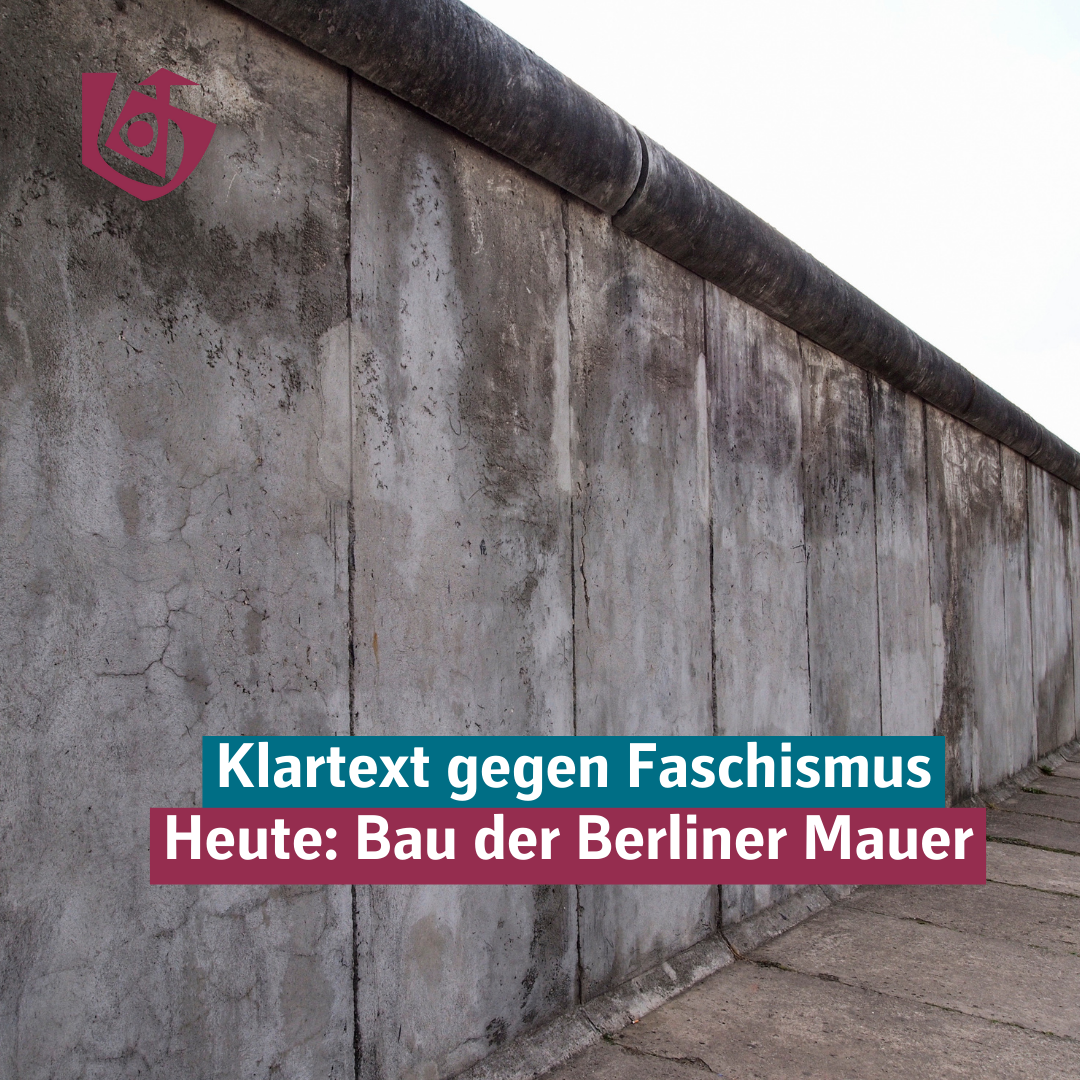
Am 13. August 1961 begannen Polizei und Armee der DDR, die Berliner Mauer zu errichten. Berlin wurde damit endgültig zur geteilten Stadt. Besuche im Westteil waren für Bürger*innen der DDR schwierig bis unmöglich. Mindestens 140 Menschen starben an der Mauer bei Fluchtversuchen oder Unfällen. Den Opfern der Berliner Mauer möchten wir heute gedenken.
In der DDR wurde die Mauer als „Antifaschistischer Schutzwall“ bezeichnet. Damit sollte deutlich werden, dass sich die DDR gegen den als faschistisch bezeichneten Westen mit einer Mauer schützen müsse. Zugleich wurde die brutale Mauerpolitik der DDR im Westen Deutschlands häufig als Fortsetzung des Faschismus „mit anderen Vorzeichen“ betrachtet.
Beide Betrachtungsweisen sind so nicht korrekt. In beiden Staaten gab es weiterhin Faschist*innen. Das Verschweigen dieser Tatsache verdeckte die Probleme nur kurzfristig. Zudem ist die nicht belegbare Bezeichnung eines Staates als faschistisch, nur um diesen in ein negatives Licht zu rücken, nicht hilfreich im Kampf gegen Faschist*innen. Es ist wichtig, genau hinzusehen, Herausforderungen differenziert zu bezeichnen und anzugehen sowie Faschismus und faschistische Tendenzen klar zu benennen und zu bekämpfen.
Mit unserer social media Kampagne möchten wir genau das tun: über rechte und extrem rechte Tendenzen aufklären, sensibilisieren und Ideen zum Einsatz gegen Faschismus aufzeigen.
Weltjugendtag

Aktuell (1.-6.8.23) findet der Weltjugendtag für junge Katholik*innen aus der ganzen Welt in Lissabon statt.
Die katholische Tageszeitung La Croix aus Paris hat eine Umfrage unter den französischen Teilnehmer*innen am Weltjugendtag in Lissabon durchgeführt. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass 14% der Teilnehmenden zum rechtsextremen politischen Spektrum gehören. Fast 20% glauben, dass „man nicht katholisch sein kann, wenn man seine Homosexualität praktiziert“.
Das zeigt: rechte und extrem rechte Einstellungen sind auch unter jungen Katholik*innen weit verbreitet und bei großen Veranstaltungen wie dem Weltjugendtag nicht selten anzutreffen.
Unsere Position dazu ist: Faschismus und Homophobie dürfen keinen Platz in der katholischen Kirche haben!
Allen, die den Weltjugendtag zur Vernetzung und Abbauen eigener Vorurteile nutzen, wünschen wir weiterhin eine gute Zeit in Lissabon!
zivile Seenotrettung

Immer wieder ertrinken Menschen auf der Flucht nach Europa. Allein in diesem Jahr sind schon über 1.000 Menschen beim Versuch gestorben, über das Mittelmeer nach Europa zu flüchten. Die Staaten der Europäischen Union schauen dem jedoch tatenlos zu. Diese Lücke füllen zivile ehrenamtliche Gruppen, die ihre Rettungsmissionen mit Spenden finanzieren. Oft wird diesen Organisationen die Zufahrt zu europäischen Häfen verwehrt und die Ehrenamtlichen werden von Behörden und Justiz angegangen.
Diese Situation ist nicht tragbar! Sichere Fluchtrouten müssen geschaffen werden und in Seenot geratene Menschen müssen vorbehaltlos gerettet werden! Alles andere ist unchristlich.
Falls du die zivile Seenotrettung unterstützen möchtest, kannst du das zum Beispiel hier: http://sea-watch.org
München, 22.7.16

Am 22. Juli 2016 erschoss ein 18-jähriger am und im Münchener Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und verletzte fünf weitere. Sieben der Todesopfer waren Muslim*innen, eines war ein Sinto und eines ein Rom. Die meisten von ihnen waren zwischen 14 und 20 Jahre alt. Heute gedenken wir der Opfer und ihrer Angehörigen.
Obwohl die rechtsextreme Gesinnung des Täters früh bekannt wurde, stuften die Behörden den Anschlag zunächst nicht als politisch motiviert ein.
Erst nach gut zwei Jahren veränderten sie diese Einstufung hin zu einer „rechtsextremistisch motivierten“ Tat. Der Täter hatte sich im Internet radikalisiert und seiner Opfer bewusst aufgrund ihres Aussehens ausgewählt.
Der Radikalisierung junger Menschen über das Internet muss entgegengewirkt werden. Staat und Gesellschaft müssen Angebote schaffen, in denen junge Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien erlernen können. Extrem Rechte Plattformen müssen durch die Behörden konsequent bekämpft werden.
“Weimarer Verhältnisse”

Im Zusammenhang mit den Aktionen der Aktivist*innen der „Letzten Generation“ sprechen einige Politiker*innen und Medien in letzter Zeit häufiger von „Weimarer Verhältnissen“. Was sie damit meinen, schauen wir uns heute näher an:
Der Begriff nimmt Bezug auf die Weimarer Republik. Das war die erste deutsche Demokratie. Sie entstand im November 1918 nach dem Ende des ersten Weltkriegs und endete im Januar 1933 mit der Machtübertragung an die Nationalsozialist*innen.
Die Weimarer Republik wurde immer wieder von schweren Krisen erschüttert, die die Demokratie bedrohten und die sie letztlich zerstörten. Darauf bezieht sich das Reden über „Weimarer Verhältnisse“.
Die großen Herausforderungen dieser Zeit waren ein zersplittertes Parlament, in dem demokratiefeindliche Parteien Mehrheiten erreichten und demokratische Parteien zu wenig zusammenarbeiteten, eine kaum kontrollierbare Inflation und Massenarbeitslosigkeit sowie gewaltsame Massenbewegungen im extremen rechten und extremen linken Spektrum, die die Demokratie gezielt bekämpften.
Auf diesem Hintergrund im Zusammenhang mit der „Letzten Generation“, deren Aktionen in Form von gewaltfreiem zivilem Ungehorsam stattfinden, von „Weimarer Verhältnissen“ zu sprechen, ist also deutlich überzogen. Denn es verstellt zum einen den Blick für die inhaltlich wichtige Thematisierung der Klimakriese und zum anderen für tatsächliche Bedrohungen unserer Demokratie durch die Arbeit einer demokratiefeindlichen Partei in den Parlamenten oder durch extrem rechte Akteur*innen in (Sicherheits-)Behörden.
Autokratie

Vielleicht hast du in den Nachrichten schon mal gehört, ein Staat sei autokratisch. Doch was bedeutet das eigentlich?
Eine Autokratie wird von einer einzelnen Person oder Personengruppe regiert, die ihre Macht unkontrolliert ausübt. So kann sie zum Beispiel die Pressefreiheit einschränken oder oppositionelle Menschen bedrohen und einsperren lassen.
Eine Autokratie steht daher im Gegensatz zur Demokratie, in der jede*r die gleichen Rechte hat, Macht beschränkt ist und die Regierung von der Opposition kontrolliert wird. Manche Autokratien versuchen sich auch mit scheinbar demokratischen Elementen aufzuwerten. Zum Beispiel halten sie Wahlen ab, die aber nicht frei sind oder manipuliert werden.
Leider gibt es aktuell auch in vielen demokratischen Staaten autoritäre Tendenzen. Dem stellen wir uns entgegen. Wir sind solidarisch mit denen, die sich mutig gegen Autokrat*innen wehren. Und wir müssen uns für die weltweite Weiterentwicklung von Freiheit und Demokratie einsetzen.
“Eskimo” vs. “Inuit”

“Eskimos” wurden lange Zeit die indigenen Bewohner*innen Grönlands, der Arktis und Sibiriens genannt. Jedoch lehnen viele der Betroffenen diese Fremdbezeichnung ab. Das liegt zum einen daran, dass ihnen der Name von den weißen Kolonisator*innen gegeben wurde. Zum anderen hing es damit zusammen, dass lange Zeit vermutet wurde, das Wort stamme vom Begriff “Rohfleischfresser” ab. Dies gilt zwar heute als widerlegt, aber der negative Beigeschmack der Bezeichnung bleibt für viele bestehen.
Als alternative Bezeichnung verwenden einige den Namen “Inuit”. Dieser umfasst aber nur einen Teil der indigenen Volksgruppen. Eine umfassende und treffende (Selbst-)Bezeichnung gibt es bisher nicht. Es ist allerdings möglich, die verschiedenen Volksgruppen einzeln zu benennen. Und vielleicht lassen sich diese eben auch nicht so einfach zusammenfassen, sondern können in ihrer Vielfalt viel sinnvoller benannt werden.
“#Stolzmonat”
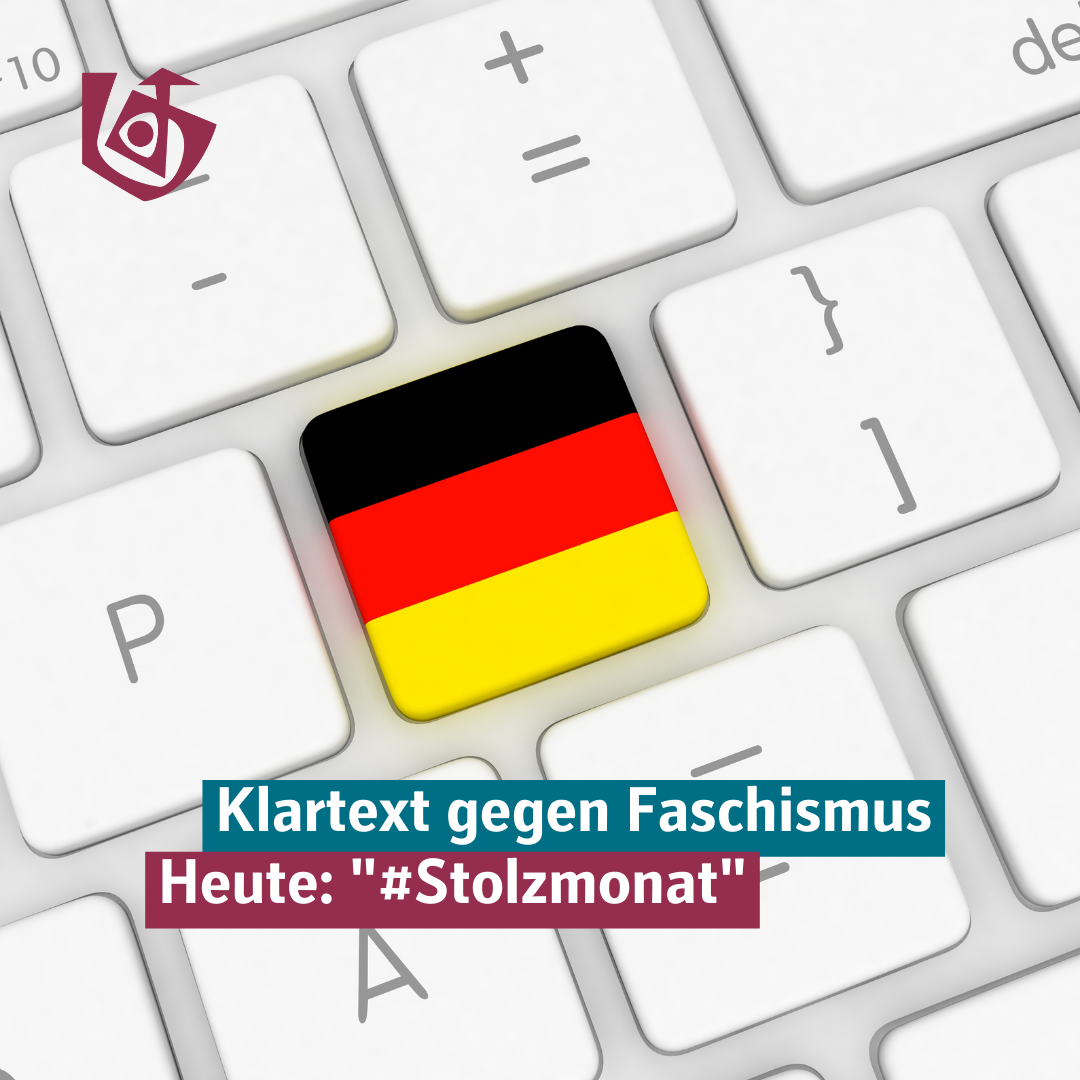
Der Juni ist Pride Month. Den gesamten Monat über setzen sich queere Menschen für ihre Rechte ein und feiern die Errungenschaften der Community.
Seit einigen Wochen versuchen extrem rechte Akteuri*nnen, dem ein Gegennarrativ entgegenzusetzen. In den Sozialen Medien rufen sie mit dem „#Stolzmonat“ dazu auf, statt der Regenbogenfahne die Deutschlandfahne zu nutzen. Damit sollen die Nutzer*innen ihren Nationalstolz zeigen und zugleich queere Menschen verhöhnen. Dabei arbeiten AfDler*innen, Transfeind*innen, rechte Internet-Trolle und Neonazis eng zusammen. Durch ihre koordinierte Arbeit versuchen sie den Eindruck zu erwecken, der Hashtag sei ein wachsender Trend.
Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass queerfeindliche Kräfte zunehmend stärker werden. Wir stehen solidarisch fest an der Seite der queeren Community!
Amadeu Antonio Stiftung

Heute möchten wir euch die Amadeu Antonio Stiftung vorstellen. Ziel der Stiftung ist es, die Zivilgesellschaft in Deutschland gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus zu stärken. Seit ihrer Gründung 1998 hat sie bereits über 1.000 lokale Initiativen und Projekten finanziell, durch Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit unterstützt. Außerdem unterstützt sie Hilfsangebote für Aussteiger*innen aus der rechten Szene. Vor kurzem hat sie zudem eine Meldestelle Antifeminismus eingerichtet.
Benannt ist sie nach Amadeu Antonio Kiowa, dem ersten Todesopfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland nach der Wiedervereinigung.
Neugierig geworden? Dann schau doch mal auf der Website der Stiftung vorbei: amadeu-antonio-stiftung.de
“christliche Werte”
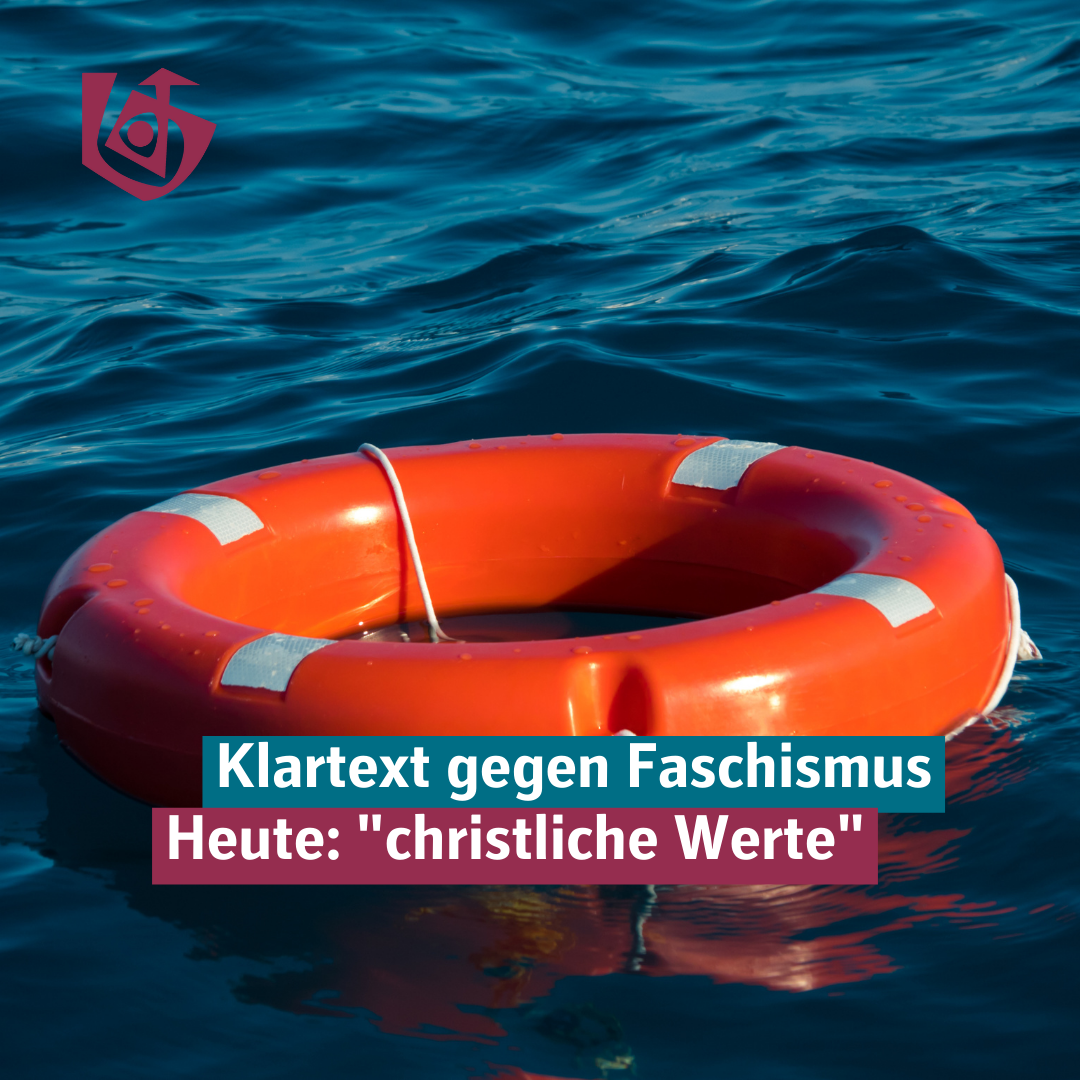
Ist dir das auch schon aufgefallen: Migrationskritische Akteur*innen betonen immer wieder, dass bei zu viel Zuwanderung nach Europa die „christlichen Werte“ in Gefahr seien. Doch was meinen sie damit eigentlich?
Bei näherem Hinschauen fällt auf, dass viele dieser Akteur*innen sich gleichzeitig vom christlichen Glauben und von der Kirche distanzieren. Sie berufen sich nur auf „christlichen Werte“, um Menschen aus Gegenden, in denen andere Religionen weiter verbreitet sind, auszuschließen. Um welche Werte es sich im Einzelnen handelt, erklären sie dabei gar nicht.
Für uns als christlicher Kinder- und Jugendverband ist klar: tatsächlich christliche Werte wie Nächstenliebe oder die Bewahrung der Schöpfung sind universell und grenzen keine*n aus.
Walter Lübcke
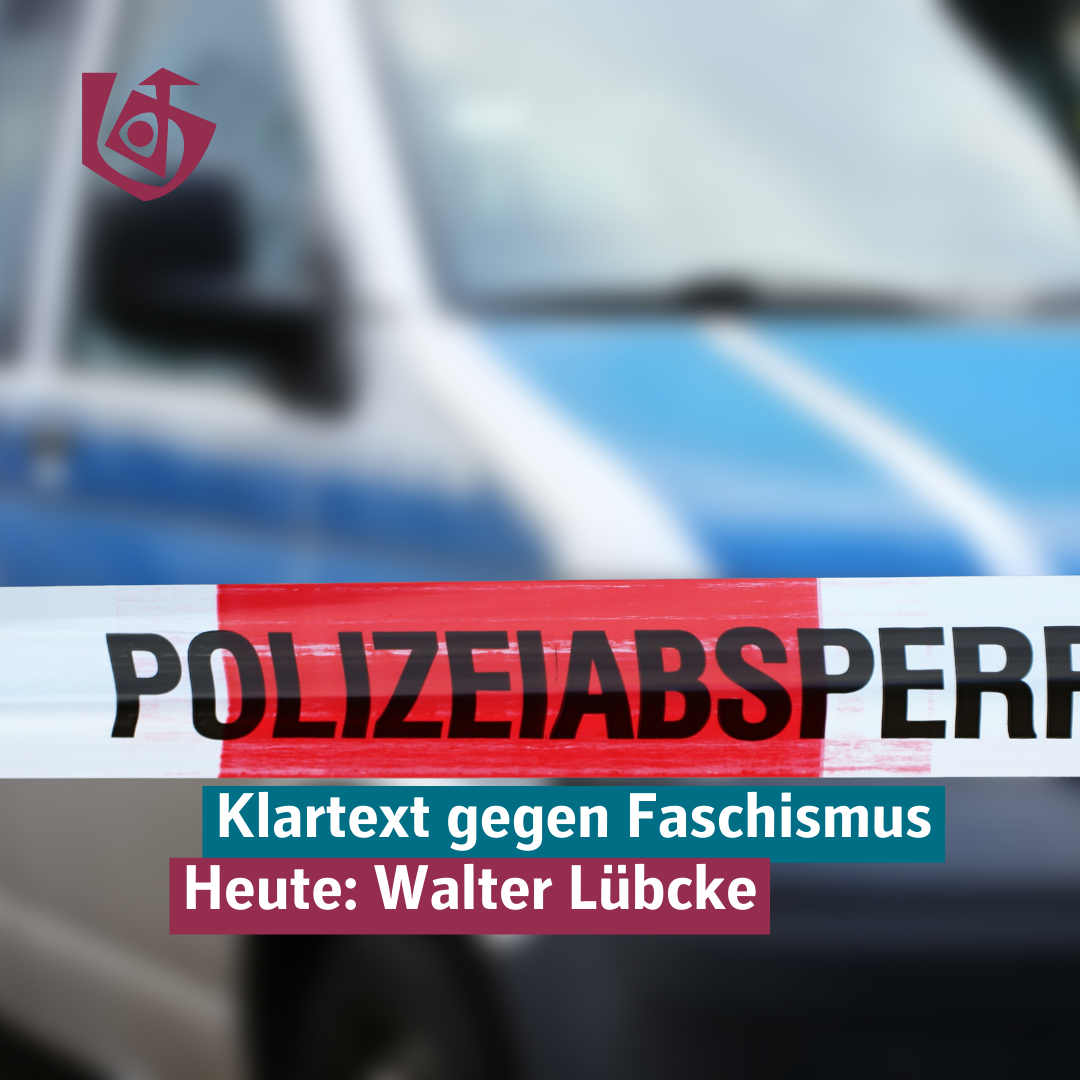
Vor rund vier Jahren wurde Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses von einem rechtsextremen Täter erschossen. Lübcke war Regierungspräsident des Regierungsbezirks Kassel. Der Täter wurde zwei Wochen später von der Polizei verhaftet. Als Motiv für seine Tat nannte er Lübckes Einsatz für Geflüchtete. Zuvor war Lübcke bereits über Jahre hinweg aus der rechten Szene bedroht worden.
Drohungen gegen Politiker*innen und ihre Familien haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Gerade in der Lokalpolitik hat dies dazu geführt, dass viele aus ihren Ämtern ausgeschieden sind. Im Fall von Walter Lübcke wurden aus Worten Taten – er verlor sein Leben.
Drohungen gegen Politiker*innen und andere gegen rechte Tendenzen engagierte Menschen müssen konsequent verfolgt werden. Die Täter*innen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, damit es keine weiteren Übergriffe oder Attentate wie auf Walter Lübcke gibt.
“Schachern”
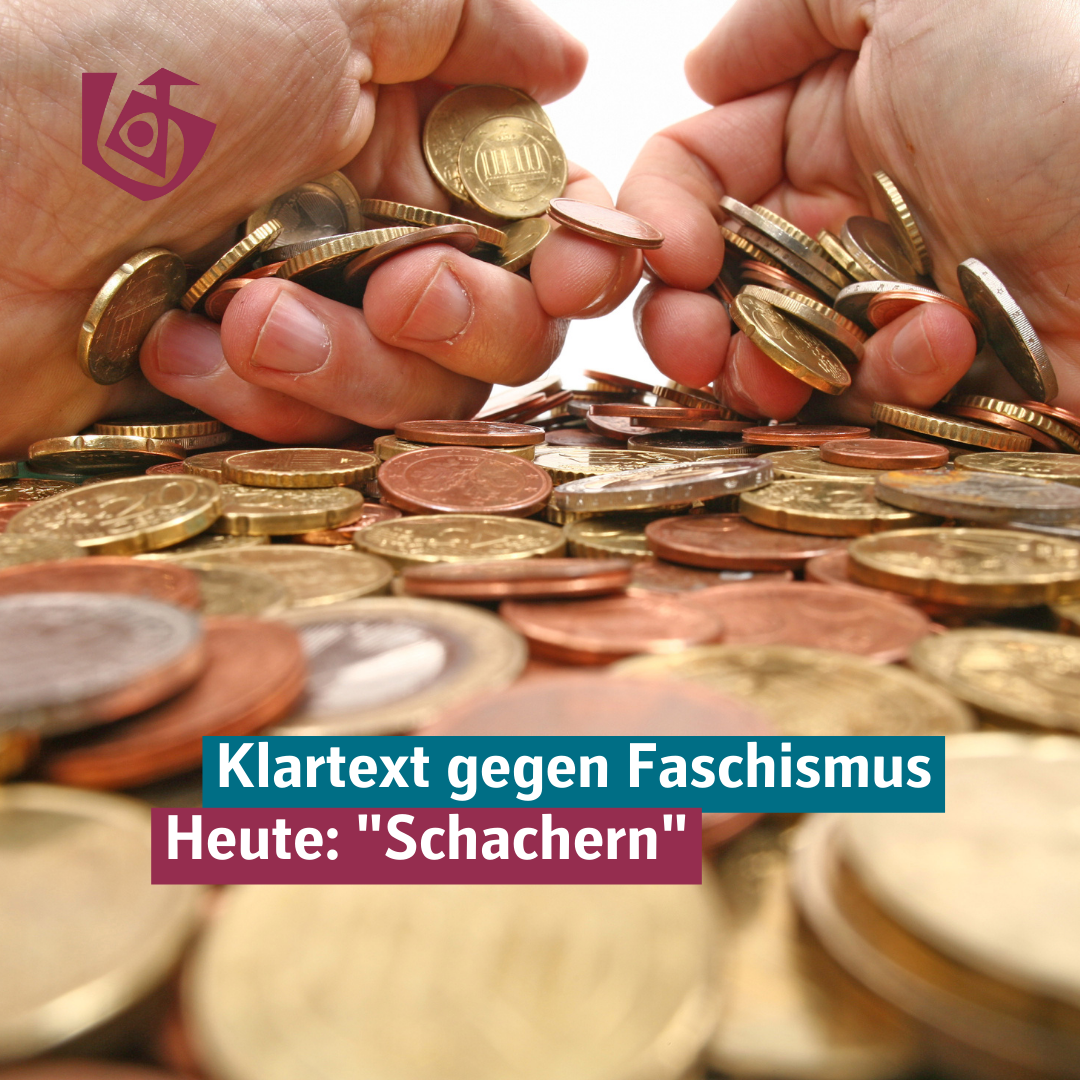
Kennst du den Begriff „Schachern“? Er wird umgangssprachlich genutzt zur Bezeichnung von unlauterem Verhalten durch Händler*innen, die möglichst hohe Gewinne erzielen wollen. Manchmal wird er auch verwendet, wenn z.B. politische Ämter intransparent vergeben werden.
Allerdings kommt das Wort ursprünglich aus dem Jiddischen. Diese Sprache wurde bis ins letzte Jahrhundert von vielen Jüd*innen in Deutschland gesprochen. Dort bedeutet der Begriff nur „Handel treiben“.
Seine negative Bedeutung in der deutschen Sprache wird somit in Verbindung gebracht mit jüdischen Händler*innen. Der Duden rät aufgrund dieser antisemitischen Verbindung dazu, den Begriff nicht in der Alltagssprache zu verwenden.
Hufeisentheorie

Die Hufeisentheorie ordnet die politischen Parteien auf einer Skala in Hufeisen-Form an. Sie unterscheidet zwischen „gemäßigten“ und „extremistischen“ Kräften. In diesem Bild sind die Enden des Hufeisens, also die extreme Rechte und die extreme Linke, näher aneinander als an der Mitte.
Diese Theorie hat jedoch mehrere Schwachstellen:
Zum einen unterstellt sie, alle außerhalb der Mitte seien undemokratisch. Gleichzeitig verharmlost sie dabei diskriminierende und autoritäre Einstellungen in der politischen Mitte. Zum anderen wird sie häufig genutzt, um demokratische linke Parteien zu disqualifizieren. Sie werden so auf eine Ebene mit demokratiefeindlichen rechten Parteien gestellt, obwohl sie kaum Gemeinsamkeiten mit diesen haben. Gleichzeitig werden dabei extrem rechte Strukturen als Randerscheinungen verharmlost, obwohl sie zum Teil bis in die Mitte der Gesellschaft hineinreichen. Die Theorie ist daher in der Wissenschaft sehr umstritten und wird von vielen Wissenschaftler*innen als undifferenziert und widerlegt betrachtet.
Bücherverbrennung
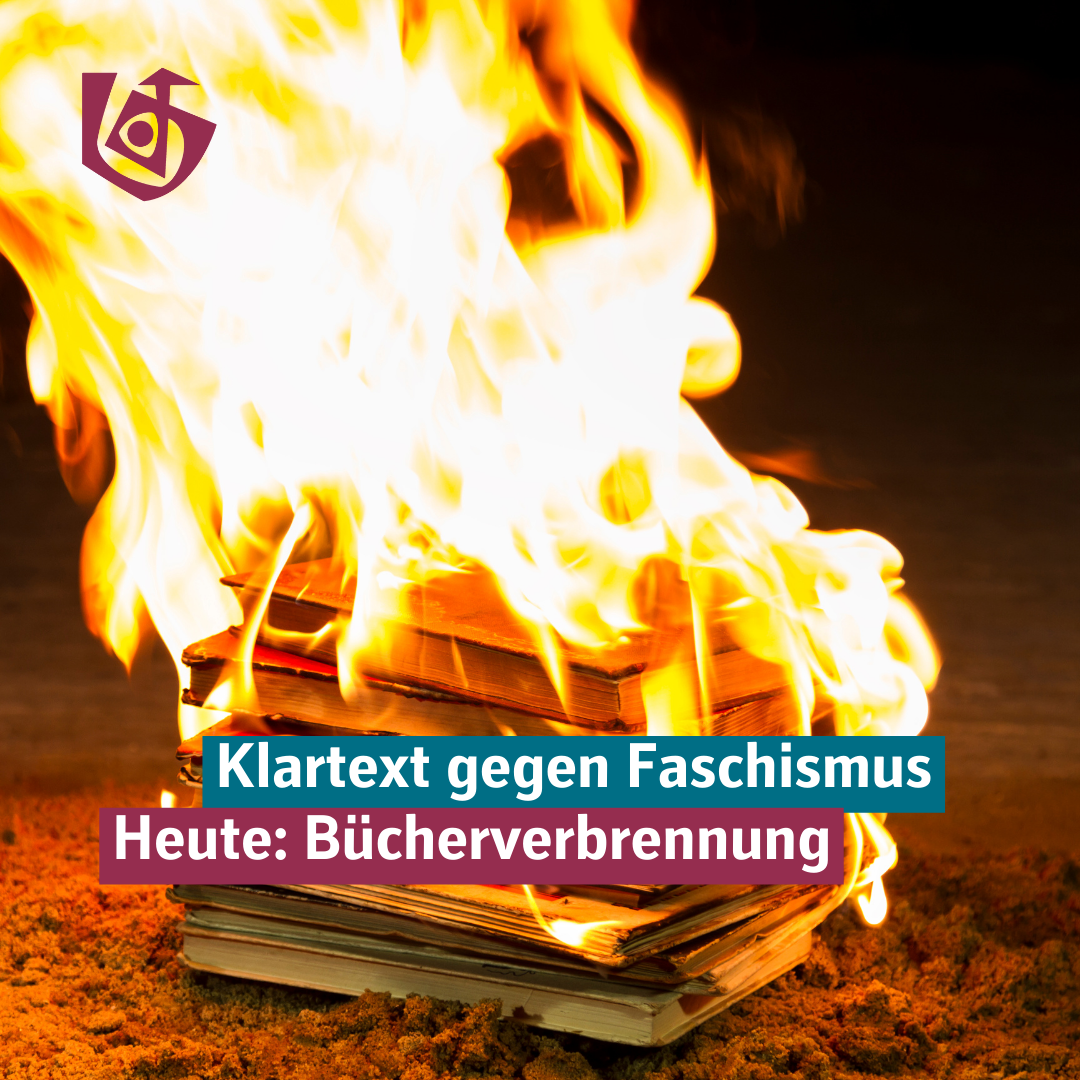
Heute (10. Mai 2023) vor 90 Jahren verbrannten die Nationalsozialist*innen in Berlin und 18 weiteren Universitätsstädten die Bücher von zahlreichen Schriftsteller*innen, die sie als „undeutsch“ betrachteten. Diese Schriftsteller*innen waren meist jüdisch, marxistisch, pazifistisch oder politisch andersdenkend. Betroffen waren z.B. Rosa Luxemburg, Erich Kästner, Nelly Sachs und Albert Einstein.
Einige der Autor*innen waren zu diesem Zeitpunkt schon ins Ausland geflohen, andere wurden von den Nationalsozialist*innen verfolgt und ermordet. Ihre Bücher wurden in Deutschland offiziell verboten.
Viele Städte erinnern heute mit Gedenkveranstaltungen an die Bücherverbrennungen. Dort wird öffentlich aus den damals verbrannten Büchern vorgelesen.
10 Jahre NSU-Prozess

Heute (6. Mai 2023) vor zehn Jahren begann der Gerichtsprozess gegen die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Die Mitglieder dieser Gruppe wurden beschuldigt, neun Menschen mit internationaler Familiengeschichte und eine Polizistin ermordet zu haben. Dazu kamen zahlreiche Mordversuche, Raubüberfälle und zwei Sprengstoffanschläge.
Vor rund fünf Jahren fiel das Urteil: Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihre mitangeklagten Helfer erhielten mehrjährige Haftstrafen. Zwei weitere Haupttäter konnten nicht angeklagt werden, da sie 2011 Suizid begangen hatten, um einer möglichen Verhaftung zu entgehen.
Zwar wurden einige Schuldige verurteilt, jedoch ist die Aufarbeitung noch lange nicht abgeschlossen. Die Verbindungen zwischen deutschen Geheimdiensten und dem NSU-Umfeld sind noch immer nicht aufgeklärt. Dies liegt auch daran, dass in den Behörden gezielt Akten zum NSU vernichtet wurden. Außerdem wurden nach einigen NSU-Morden zunächst Familienangehörige der Opfer verdächtigt. Von staatlicher Seite sind die Hinterbliebenen lange kaum unterstützt worden. Zehn Jahre nach dem juristischen Prozessbeginn und fünf Jahre nach dessen Ende muss der politische Aufarbeitungsprozess weitergehen, damit den Opfern und ihren Angehörigen Gerechtigkeit zuteilwird und rechter Terrorismus in Deutschland zukünftig keine Chance hat.
Vielfalt-Mediathek

Du hörst rechte Sprüche auf der Straße? Du bemerkst Diskriminierungen? Du willst etwas dagegen tun? Dann bist du in der Vielfalt-Mediathek goldrichtig.
Die Vielfalt-Mediathek des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit (IDA) e.V. bietet dir fast 4.000 Bildungsmaterialien, die du kostenlos nutzen kannst. Die Mediathek ist auch als App verfügbar.
Damit kannst du online wie offline auf Übungen, Methoden und Konzepte zugreifen, die helfen, lösungsorientiert gegen Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und Gewalt vorzugehen und dich für Demokratie, Vielfalt und Anerkennung einzusetzen.
Den Link zur Vielfalt-Mediathek findest du hier: http://www.vielfalt-mediathek.de/
Rechtsextremismus
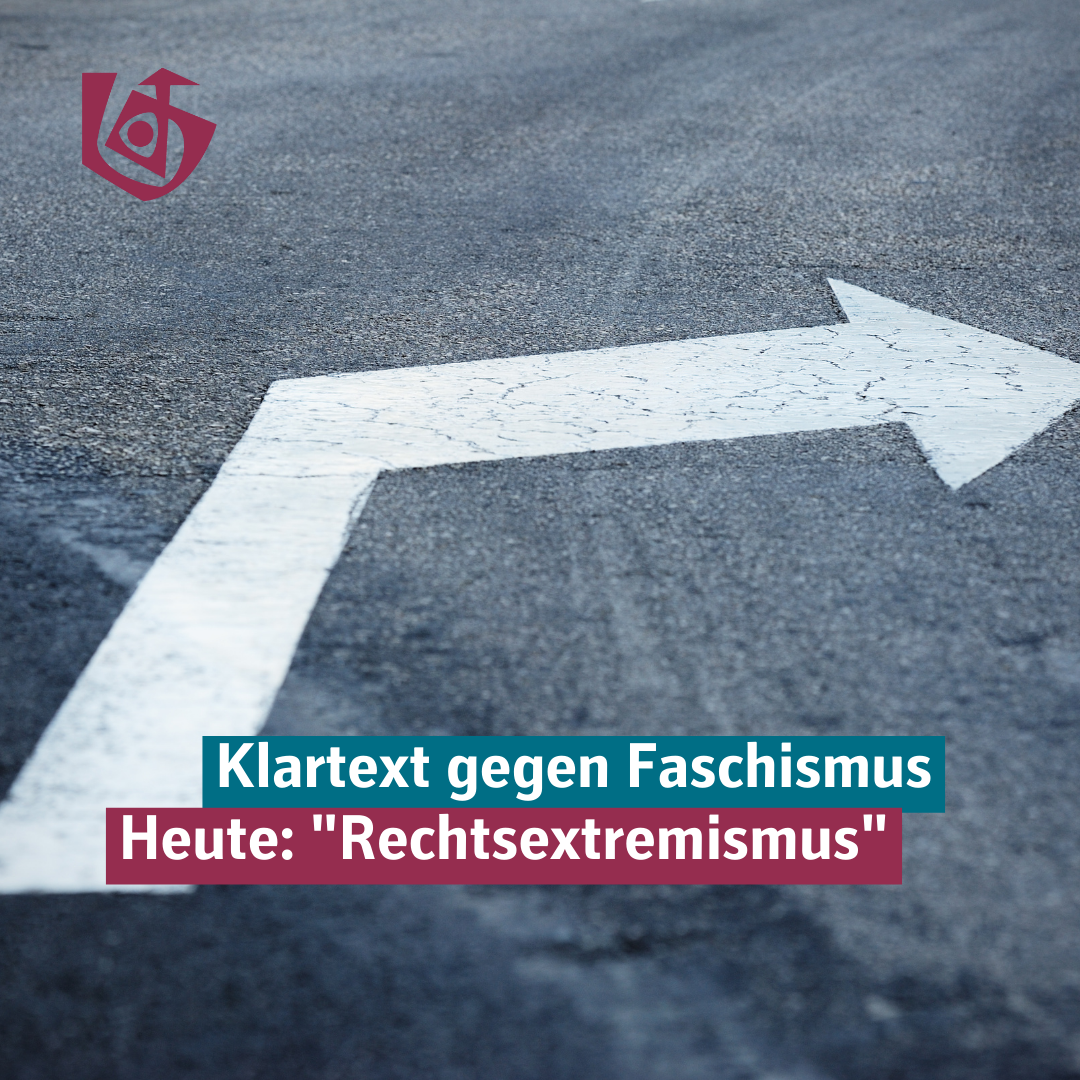
Der Begriff „Rechtsextremismus“ ist ein Sammelbegriff für Akteur*innen und Phänomene, die extrem rechte Ideologien vertreten oder extrem rechte Handlungen durchführen.
Für eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Akteur*innen und Phänomene sollte er jedoch aufgespalten werden: Die Benennung einer Aussage als rassistisch, antisemitisch oder sexistisch ist z.B. hilfreicher, als sie einfach als rechtsextrem zu benennen. Denn so lässt sich gezielter gegen problematische rechte Verhaltensweisen vorgehen.
Außerdem wird dabei ein Extremismus-Begriffs vermieden, der rechte, linke, religiös-fundamentalistische und andere Ideologien in einen Topf wirft und dadurch einen angemessenen Umgang mit ihnen erschwert. Ebenfalls zu bedenken ist, dass der Begriff „Rechtsextremismus“ die politische „Mitte“ von vornherein freispricht. Denn er erweckt den Eindruck, es handle sich um ein randständiges Phänomen, obwohl einzelne Ideologiebestandteile der extremen Rechten längst ihren Weg in diese „Mitte“ gefunden haben.
Als Sammelbegriff für eine Gesamtbetrachtung der extremen Rechten ist der Begriff trotzdem geeignet, da er das große Ausmaß extrem rechter Einstellungen und Handlungen erfassbar macht.
Gender-Ideologie

In der KjG bemühen wir uns, alle Menschen gleichberechtigt anzusprechen. Deshalb sprechen wir zum Beispiel von Christ*innen statt von Christen. Verschiedene Akteur*innen aus konservativen, rechten und religiös-fundamentalistischen Gruppen lehnen diese geschlechtersensible Sprache ab. Das sei Teil der „Gender-Ideologie“. Sie argumentieren, dass Menschen sich strikt in Mann und Frau einteilen lassen und begründen dies mit der Biologie. Dabei ignorieren sie, dass auch die biologische Forschung belegt, dass es mehr Geschlechter gibt.
Queere Menschen werden von ihnen als Bedrohung für „die natürliche Ordnung der Gesellschaft“ gesehen. Dass diese „natürliche Ordnung“ auf der Unterdrückung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen beruht, verschweigen sie.
Als Christ*innen sind wir überzeugt, dass jeder Mensch, so wie er*sie ist, von Gott+ gewollt ist. Gott+ hat die Welt als einen Ort der Vielfalt geschaffen, an dem jede*r ihren*seinen Platz hat.
Autoritarismus-Studie
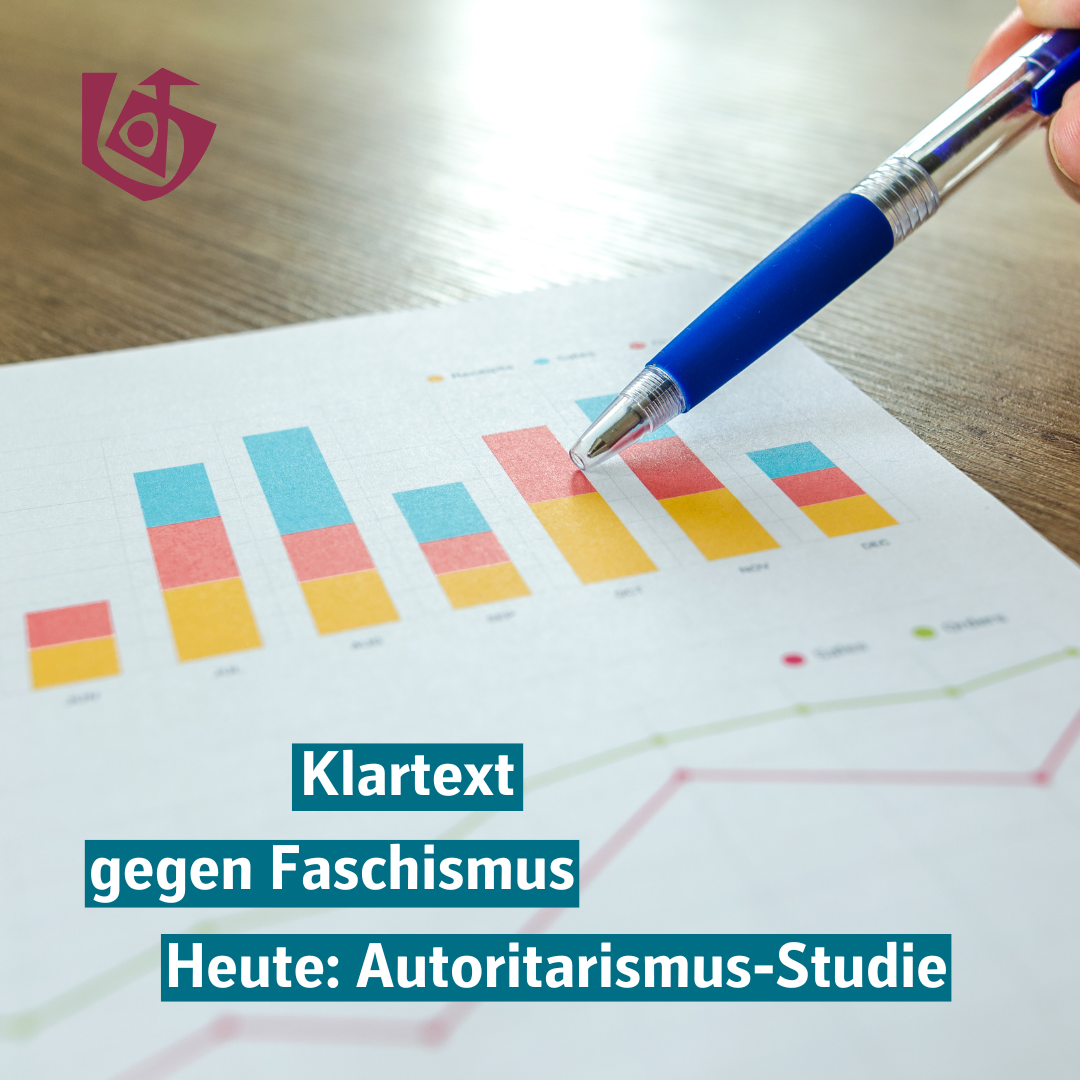
Hatte der Nationalsozialismus auch seine guten Seiten?
Mehr als jede*r fünfte Deutsche stimmt dem teilweise oder ganz zu.
Sind „die Deutschen“ anderen „Völkern“ von Natur aus überlegen?
Dem stimmt mehr als jede*r vierte Deutsche teilweise oder ganz zu.
Haben „die Juden“ etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen daher nicht „zu uns“?
Dem stimmt fast jede*r vierte Deutsche teilweise oder ganz zu.
Und könnte eine Diktatur eventuell die bessere Staatsform sein? Dem stimmt mehr als jede*r siebte Deutsche teilweise oder ganz zu.
Diese Zahlen stammen aus der Leipziger Autoritarismus-Studie von 2022. Und sie zeigen: autoritäre, antisemitische und die Geschichte verzerrende und verharmlosende Einstellungen reichen tief in unsere Gesellschaft hinein. Das gefährdet unsere Demokratie!
Als pluralistische Demokrat*innen stellen wir uns klar gegen solches Gedankengut und sprechen uns dafür aus, die politische und historische Bildungsarbeit zu stärken, um diesem Gedankengut effektiv entgegenzuwirken.
Mobile Beratung

Begegnen dir in deinem Alltag Menschen mit extrem rechten Ansichten und Verhaltensweisen? Oder möchtet ihr eine Weiterbildung zum Umgang mit Rechtspopulist*innen machen?
Dann sind die bundesweiten Mobilen Beratungsteams gute Ansprechpartner*innen für euch.
Die Teams beraten und begleiten im Umgang mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungserzählungen. Die Angebote sind kostenfrei, vertraulich und können direkt bei euch vor Ort durchgeführt werden. Auf der Website des Bundesverbands Mobile Beratung findet ihr eine Übersicht über die deutschlandweit verteilten Teams.
Ermächtigungsgesetz

Vor 90 Jahren, am 24. März 1933, beschloss der Deutsche Reichstag, das Parlament der ersten deutschen Demokratie, das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Bewaffnete Mitglieder der SA und der SS setzten die Abgeordneten dabei durch ihre Anwesenheit im Reichstag unter Druck. Trotzdem stimmten 94 Abgeordnete unter hohem persönlichen Risiko gegen das Gesetz.
Mit dem Ermächtigungsgesetz schaltete das Parlament sich selbst und damit auch die Demokratie aus. Es übertrug seine gesetzgebende Gewalt an Adolf Hitler. Mit dieser Maßnahme endete die Gewaltenteilung und die Nazis konnten ihre Macht endgültig festigen.
Ein solches Sterben einer Demokratie darf sich niemals wiederholen! Wir setzen uns deshalb als Verband dafür ein, dass Kinder schon von klein auf lernen, in demokratischen Prozessen mitzubestimmen und so den Wert einer Demokratie zu erkennen.
Reichsbürger*innen

In den letzten Wochen berichteten die Medien immer wieder über Reichsbürger*innen. Doch wer sind die eigentlich?
Hier ein paar Fakten:
-> Die Reichsbürger*innenbewegung ist keine einheitliche Gruppe. Meist handelt es sich um Einzelpersonen oder Kleingruppen.
-> Reichsbürger*innen lehnen die Bundesrepublik Deutschland ab. Sie behaupten, dass das Deutsche Reich weiterbestehe.
-> Damit einher gehen bei vielen von ihnen rechtsextreme Einstellungen und die Leugnung der Verbrechen des Nationalsozialismus. In der Regel lehnen sie Demokratie und eine pluralistische Gesellschaft ab und befolgen Beschlüsse von Gerichten und Behörden nicht.
-> Viele Reichsbürger*innen besitzen Waffen. Seit im Jahr 2016 ein Reichsbürger einen SEK-Beamten erschoss, wird die gesamte Szene vom Verfassungsschutz beobachtet.
-> In den letzten Monaten flogen immer wieder Reichsbürger*innengruppen auf, die Pläne für einen Umsturz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland vorbereiteten.
-> Im Jahr 2023 zählte der Verfassungsschutz ca. 23.000 Reichsbürger*innen in Deutschland.
Antifeminismus

Anlässlich des internationalen Frauentags in dieser Woche lohnt sich ein Blick auf die Leipziger Autoritarismus-Studie aus dem vergangenen Jahr. Die Studie hat ergeben, dass ca. ein Drittel der Männer ein geschlossen antifeministisches Weltbild aufweisen. Bei den Frauen hat knapp ein Fünftel antifeministische Einstellungen. Insgesamt stimmt somit ein Viertel der Deutschen antifeministischen und sexistischen Aussagen zu. Zwei Jahre zuvor war es nur knapp ein Fünftel – dieser Wert ist also stark gestiegen.
Der Antifeminismus lehnt Themen wie reproduktive Selbstbestimmung oder Debatten um Konsequenzen von sexualisierter Gewalt durch Männer ab. Er will die patriarchale, heteronormative Dominanz mit ihren klaren Rollenvorstellungen schützen. Damit verbunden sind Bilder einer hegemonialen Männlichkeit, die letztlich zu Gewalt gegen Frauen und queere Menschen führen kann. Insbesondere junge Männer radikalisieren sich dabei häufig über die sozialen Medien, in denen oft problematische Männlichkeit vorgelebt und reproduziert wird.
Hintergrund der Leipziger Autoritarismus-Studie: Die Studie ist eine Langzeiterhebung der Universität Leipzig in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto-Brenner-Stiftung. Sie erscheint seit 2002 in einem Zweijahres-Rhythmus und wirft einen Blick auf politische und antidemokratische Einstellungen in Deutschland.
Rechtspopulismus
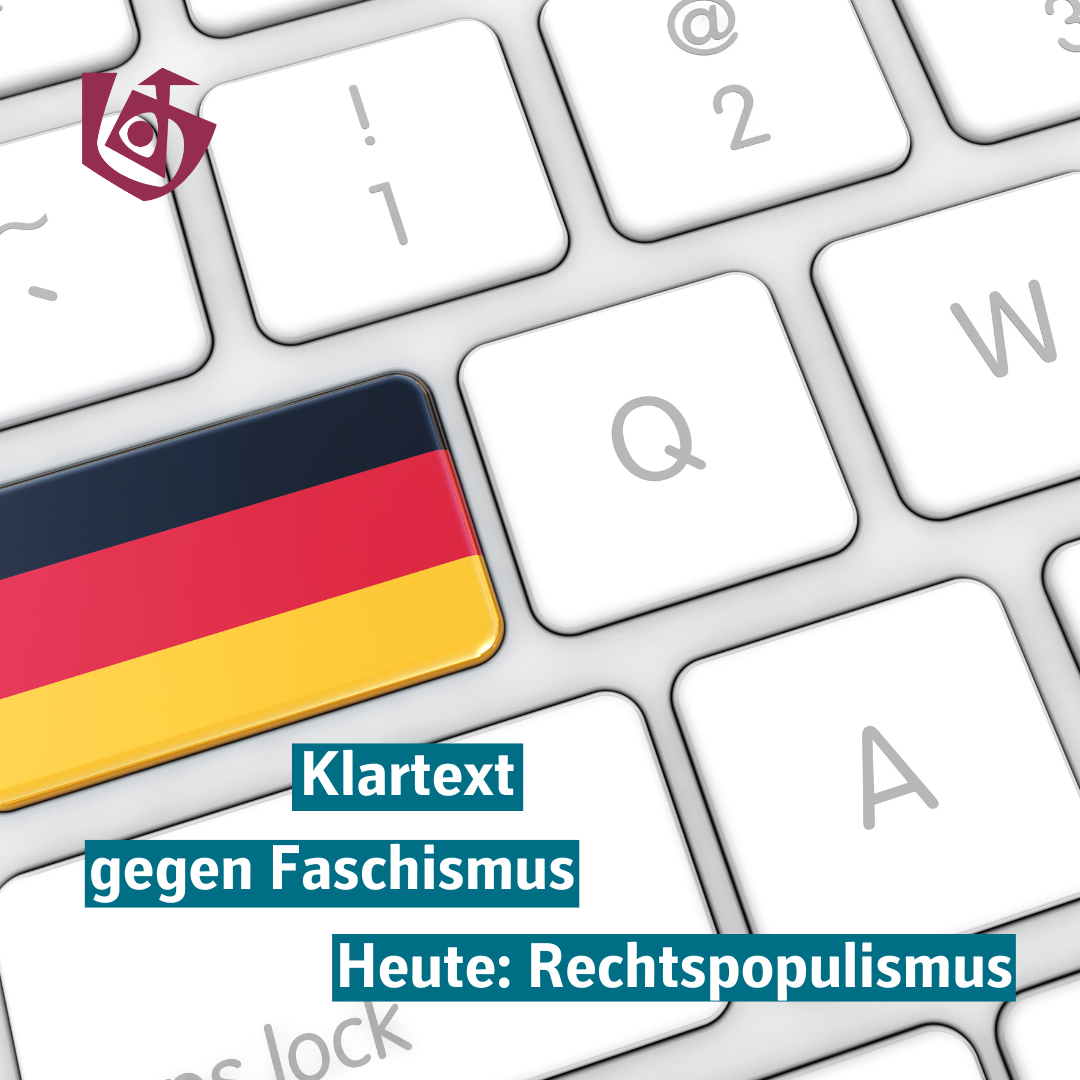
Der Begriff „Rechtspopulismus“ ist dir in den Medien und in der politischen Debatte bestimmt schon häufiger begegnet.
Aber was bedeutet er?
Eine einheitliche Definition gibt es nicht. Aber die Kernelemente des Rechtspopulismus lassen sich trotzdem klar identifizieren:
Rechtspopulist*innen stellen sich selbst als Vertreter*innen „des Volkes“ dar. „Das Volk“ ist für sie eine einheitliche Gruppe. Sie behaupten, diese Gruppe gegen zwei angebliche Bedrohungen schützen zu wollen. Zum einen gegen „die da oben“, also Politiker*innen, Journalist*innen, kritische Wissenschaftler*innen usw. Zum anderen gegen „die Anderen“. Dies sind Menschen mit internationaler Familiengeschichte, politisch Andersdenkende, queere Menschen, aber auch sozial Benachteiligte (z.B. Bürger*innengeld-Bezieher*innen) usw.
Rechtspopulist*innen werfen Menschen aus diesen Gruppen vor, nur auf eigene Interessen bedacht zu sein, “dem Volk” zu schaden oder „das Volk“ von der Mitbestimmung ausschließen zu wollen. Um ihre Ansichten zu verbreiten, schüren Rechtspopulist*innen Ängste, provozieren und brechen Tabus, verbreiten Verschwörungserzählungen und fordern radikale Lösungen.
Konkrete Antworten auf politische Fragen und Herausforderungen liefern sie in der Regel nicht.
In der KjG als demokratischem Verband wissen wir, dass es selten DIE Lösung gibt, dass es sich lohnt, verschiedene Wege durchzudenken, darüber zu diskutieren und sich möglichst gemeinsam für die aktuell sinnvollste Idee zu entscheiden.
Die Weiße Rose

Es kostet sehr viel Mut, sich gegen ein diktatorisches Regime zu stellen, denn oft geschieht dies unter hohem Risiko für das eigene Leben. Das galt auch für die Geschwister Sophie und Hans Scholl sowie für Christoph Probst – drei führende Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Heute (22. Februar) vor 80 Jahren wurden sie hingerichtet.
Die meisten Mitglieder der Weißen Rose leisteten aufgrund ihres christlichen Glaubens Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Sie waren entsetzt über den Umgang mit Jüd*innen und Regimegegner*innen sowie über die Ermordung von Menschen mit Behinderung. Sie begannen heimlich regimekritische Flugblätter zu drucken und zu verteilen.
Am 18. Februar wurden die Geschwister Scholl bei einer solchen Aktion an der Münchener Universität verhaftet. Da sie noch einen Flugblattentwurf von Christoph Probst bei sich trugen, verhafteten die Nazis auch ihn. Nur vier Tage später, am 22. April 1943, wurden die drei in einem Schauprozess vor dem „Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt und anschließend hingerichtet.
Heute gedenken wir ihnen und allen, die im Kampf gegen den Nationalsozialismus ihr Leben verloren haben. Zugleich verpflichtet uns das Gedenken auch zur Solidarität mit allen, die auch heute unter großem persönlichen Risiko Widerstand gegen Unrechtsregime leisten.
Hanau, 19.2.20

Am Sonntag jährt sich der rechtsextreme Terroranschlag vom 19. Februar 2020 zum dritten Mal. Dort erschoss ein 43-Jähriger neun Hanauer*innen mit internationaler Familiengeschichte:
Gökhan Gültekin
Sedat Gürbüz
Said Nesar Hashemi
Mercedes Kierpacz
Hamza Kurtović
Vili Viorel Păun
Fatih Saraçoğlu
Ferhat Unvar
Kaloyan Velkov
Wir gedenken der Opfer dieser rassistischen Tat.
Und wir fordern eine umfassende politische Aufarbeitung. Warum durfte der Täter Schusswaffen besitzen, obwohl er bereits auffällig geworden war? Warum war der polizeiliche Notruf zur Tatzeit nicht erreichbar? Warum wurden einige der Angehörigen unmittelbar nach der Tat mit Gefährder*innenansprachen durch die Polizei konfrontiert? Der Anschlag von Hanau muss aufgearbeitet werden, damit rechtsextremer Terror in Zukunft verhindert werden kann.
Antifaschismus

Der Begriff „Antifaschismus“ bezeichnet eine Grundhaltung gegen jede Form von Faschismus. Schon in den 1920er-Jahren stand der Kampf gegen die stärker werdenden faschistischen Parteien unter diesem Namen. Antifaschist*innen kamen und kommen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Zum Beispiel aus Parteien und Gewerkschaften, aus sozialen Bewegungen und aus den Kirchen. Aktuell setzen sie sich gegen Rechtsextremismus und dessen gesellschaftliche Ursachen ein.
Faschistische und rechtsextreme Einstellungen widersprechen unserer Grundüberzeugung als christlichem und demokratischem Verband. Deshalb sind auch wir Antifaschist*innen.
“Reibach”

Kennst du die Redewendung “Reibach machen”?
Laut dem Duden bedeutet das Wort „Reibach“ einen „(durch Manipulation erzielten) unverhältnismäßig hohen Gewinn bei einem Geschäft“. Der Begriff stammt vom jiddischen Wort „rewach“ (deutsch: Zins) ab. Bei dem Begriff wird eine Verbindung zwischen unlauteren Geschäftspraktiken und Jüd*innen hergestellt. Der Begriff ist also antisemitisch und daher empfehlen wir klar, ihn nicht zu nutzen.
Netzwerk Demokratie und Courage
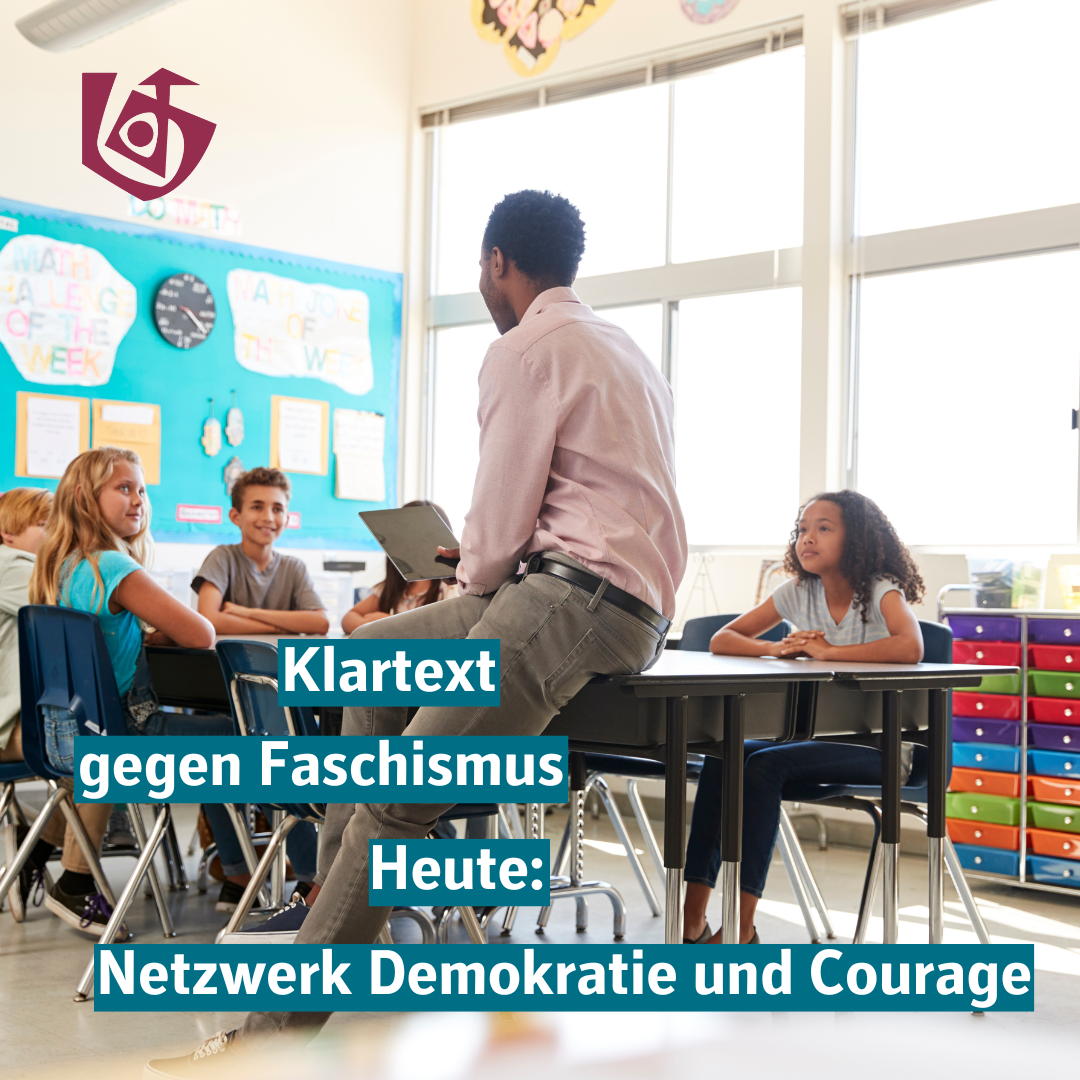
Im Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) engagieren sich bundesweit junge Menschen für Demokratieförderung und gegen menschenverachtendes Denken. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des NDC führen Projekttage zu verschiedenen Themen an Schulen durch. Zum Beispiel zu Diskriminierung, Rassismus, Neonazismus oder auch zu Zivilcourage.
Könnte so ein Projekttag auch etwas für deine Schulklasse sein? Oder bist du bereits über 18 und hast Lust, selbst als Teamer*in Projekttage durchzuführen? Dann schau doch mal auf der Website des NDC vorbei: http://www.netzwerk-courage.de
“Mauscheln”
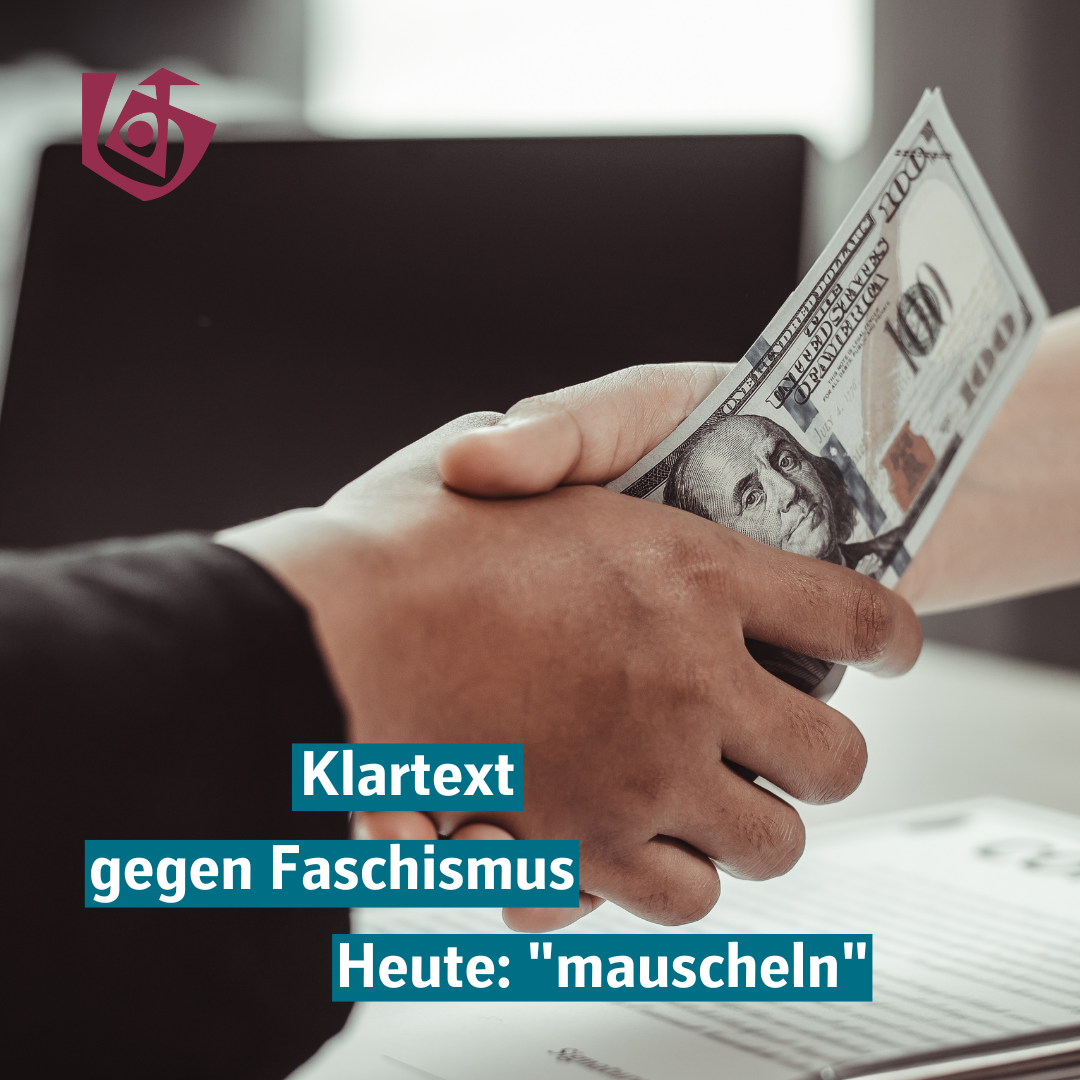
„Mauscheln“ bedeutet laut Duden „unter der Hand in undurchsichtiger Weise Vorteile aushandeln, begünstigende Vereinbarungen treffen, Geschäfte machen“ oder „beim Kartenspiel betrügen“. Weniger bekannt ist, dass dieses Wort seit dem 17. Jahrhundert als antisemitischer Spottname für Jüd*innen und besonders für jüdische Händler*innen verwendet wurde. Es leitete sich vermutlich von der jiddischen Aussprache des Namens Mose ab. Wir möchten daher auf dieses Wort im Sprachgebrauch verzichten.
Blackfacing

Blackfacing: Wenn mensch sich als weiße Person schwarz schminkt, nennt sich das Blackfacing. Der Begriff geht zurück auf die “Minstrel-Shows” des 18. und 19. Jahrhunderts in den USA. Dort malten sich weiße Menschen schwarz an, um Menschen mit schwarzer Hautfarbe darzustellen – in der Regel klischeehaft und abwertend.
“Indianer”/ “Chinese”/ “Mexikaner”/ “Eskimo”/ …: Bei Kostümen wie diesen wird eine heterogene Bevölkerungsgruppe auf ihre Stereotype reduziert. Es werden Minderheiten dargestellt, die alltäglich von Diskriminierung betroffen sind. Zudem wird oft der historische Kontext vergessen und das Leben der Bevölkerungsgruppe romantisiert.
Z.B. beinhaltet die Geschichte indigener Amerikaner*innen Kolonisierung und damit Vergewaltigungen, Vertreibung und Ermordungen durch europäische Siedler*innen im 15. Jhd., ebenso wie Zwangsumsiedlungen im 19. Jhd.
Kostüme bedienen fast immer Stereotype und Klischees. Wenn das Kostüm eine gesellschaftliche Minderheit stereotypisiert kann das Diskriminierungen verstärken. Vor allem, wenn du als weißer Mensch gesellschaftlich privilegiert bist, ist es sehr sinnvoll, dich zu fragen, ob dein Kostüm andere Personen(gruppen) verletzt.
Faschismus
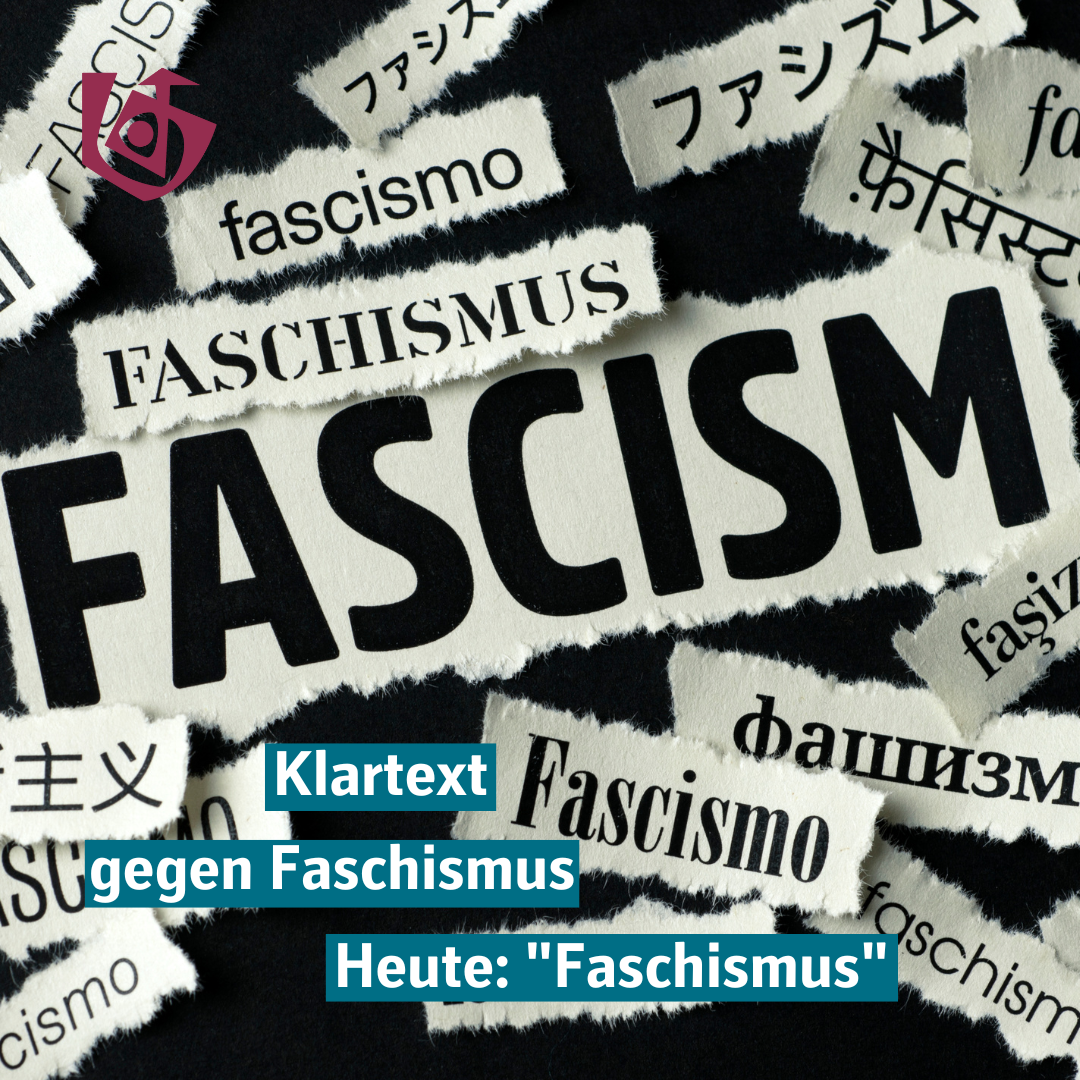
Der Begriff „Faschismus“ bezeichnet eine politische Ideologie. Faschistische Bewegungen und Parteien sind nach dem sogenannten „Führer*innenprinzip“ aufgebaut. Das heißt: Eine Person steht an der Spitze der Gruppe und trifft alle Entscheidungen. Dieses Prinzip wollen Faschist*innen auf das politische System übertragen und so die Demokratie abschaffen.
Im Kern der faschistischen Ideologie steht eine rassistisch-nationalistische Weltsicht. Faschist*innen grenzen Menschen aus, die sie als nicht zum eigenen „Volk“ gehörend betrachten.
Das sind zum Beispiel:
- Menschen mit internationaler Familiengeschichte oder mit einer anderen Religion,
- Feminist*innen,
- queere Menschen,
- politisch Andersdenkende.
Ihre Ziele versuchen Faschist*innen auch mit Gewalt umzusetzen. Bewegungen und Menschen mit faschistischen Denkmustern sind auch heute noch weltweit zu finden. Als christlicher und demokratischer Verband positionieren wir uns klar gegen Faschismus.
